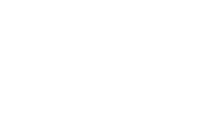Alles kann, nichts muss
Freiburg, 26.04.2017
Sie entspricht nicht der Faulheit, ist nicht mit Freizeit gleichzusetzen, und Langeweile trifft es schon gar nicht: Was, bitte schön, ist denn eigentlich „Muße“? In einem Sonderforschungsbereich (SFB) arbeiteten Freiburger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Philosophie, Literaturwissenschaft, Theologie, Kunstgeschichte, Soziologie, Psychologie und Ethnologie von 2013 bis 2016 an einer Art Kulturgeschichte des Phänomens. Rimma Gerenstein hat mit der Mediävistin Rebekka Becker, der Anglistin Pia Masurczak und der Psychologin Minh Tam Luong gesprochen, die ihre Dissertationen in diesem SFB geschrieben haben.

Paradies der Muße: In der Minnegrotte leben Tristan und Isolde vergnügt und erzählen sich Geschichten von sehnsüchtiger Liebe – Isoldes Mann König Marke bleibt verstimmt am Hof zurück. Gemälde: Edmund Leighton 1902. Quelle: Wikimedia Commons
Wo haben Mönche und Nonnen Muße erlebt? Kommen Bauern, die den ganzen Tag auf dem Acker schuften, manchmal auch in ihren Genuss? Wie inszenieren literarische Werke vom Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert die Muße? Und welche Rolle spielt sie in der heutigen Zeit, in der Begriffe wie „Entschleunigung“ und „Achtsamkeit“ fast jeden Ratgeber besiedeln? Die Forscherinnen und Forscher des SFB haben über die Jahrhunderte hinweg ein und dasselbe Muster gefunden: Muße kann eine Minute oder eine Stunde dauern und überall eintreffen – im Beauty-Spa genauso wie am Schreibtisch oder auf einem belebten Bahnhof. Sie dient keinem Zweck, weder der Erholung noch der Entspannung. Trotzdem kann sie Freiräume schaffen, für einen Moment den Alltag mit all seinen Zwängen ausblenden und den Menschen inspirieren. Doch Muße lässt sich nicht erzwingen oder festhalten. Und sie ist auch nicht ungefürchtet: Schließlich birgt sie die Gefahr, dass Menschen gleichgültig werden, den Ehrgeiz verlieren und ihre Verpflichtungen vernachlässigen.
Den Federn verfallen
Skeptisch standen Hartmann von Aue oder Gottfried von Straßburg, die mittelhochdeutsche Verse dichteten, der „muoze“ gegenüber – sie brachten sie mit Trägheit oder sogar mit Sünde in Verbindung. Überhaupt ist Muße nichts, was man im höfischen Roman vermuten würde; das Mittelalter lässt eher an die Losung „ora et labora“ denken – oder an „arbeit umbe êre“, wie es die Artusromane um 1200 propagierten: „Hauptsächlich war es die Aufgabe der Ritter, in die Welt hinauszuziehen und zu kämpfen. Nichts durfte sie auf ihren Aventürefahrten aufhalten“, sagt Rebekka Becker. Kamen sie mit zerbeulten Schilden von diesen Abenteuern zurück, brachte es ihnen das Ansehen der Adligen am Hofe ein. So das Ideal.
Doch die „êre“ kam den Rittern schnell abhanden, sobald sie sich ihren Pflichten entzogen. Dies zeigten auch die Versdichtungen, erklärt die Mediävistin: „Wenn die Figuren Muße erleben, dann findet das immer abseits der Gesellschaft statt. Der Ritter Iwein kommt zum Beispiel vom Weg ab und wandelt durch einen Garten mit Lindenbäumen, Wasserquellen und Vogelgezwitscher – ein Frei- und Spielraum, der als Gegenbild zur strengen Repräsentationskultur des Hofes zu verstehen ist.“ Auf das untätige Verweilen folgt aber die Strafe: Den „Müßiggängern“ begegnet Missachtung, hinter ihrem Rücken wird gelästert, und das schlechte Gewissen quält sie. Als sich der Königssohn Erec mit seiner Frau Enite wochenlang zurückzieht und seinem Liebesleben frönt, werden die Untertanen unzufrieden, und die Freude des Hofes droht zu verschwinden. Negativ und bisweilen mit ironischem Unterton kommentiert der Erzähler den Zustand, wenn sich ein Mann „verliget“, sprich: nicht mehr aus dem Bett kommt.

Die so genannten Nautch Girls vollführten traditionelle indische Tänze – für viele Briten, die im Auftrag der East India Company nach Indien gekommen waren, gehörten ihre Auftritte zu einem begehrten Zeitvertreib, bei dem sie Muße erleben wollten.
Foto: Library of Congress/LC-USZ62-35125
Becker betont den Widerspruch, den die Romane zeigen: „Wenn sich ein Herrscher zurückzieht, steht der ganze Hof auf dem Spiel.“ Gleichzeitig festigte die Muße den Status der Elite: „In der mittelalterlichen höfischen Kultur, wie sie in den Texten inszeniert ist, waren die Adligen die einzige Schicht, die überhaupt in den Genuss solcher Momente kam.“
Schlapp im Süden, fit im Norden?
Wer die Macht hat, hat also auch die Muße? Blickt man ins 18. und 19. Jahrhundert, scheint sich das Blatt zu wenden. Pia Masurczak hat Reiseberichte britischer Kolonialisten untersucht, die im Auftrag der East India Company nach Indien übersiedelten. In den Augen der Kaufleute, Aristokraten und Politiker sei Müßiggang oft zum Synonym für Trägheit geworden, sagt die Anglistin: „Sie konnten zum Beispiel nicht verstehen, warum ihre indischen Hausangestellten so unproduktiv waren.“ Ein Wasserträger war eben nur fürs Wassertragen zuständig und hat nicht noch nebenbei das Abendessen zubereitet – ein Zeichen für Faulheit, schimpften die Ladys und Gentlemen. „Dabei liegt die strikte Arbeitstrennung im Kastenwesen begründet.“
Die Frage, wer vermeintlich müßig in den Tag hineinlebte und wer arbeitsam die Gesellschaft aufrechterhielt, schlug sich auch in wissenschaftlichen Arbeiten der damaligen Zeit nieder. Vertreter der Klimatheorie machten die hohen Temperaturen dafür verantwortlich, dass die südlichen Völker langsamer und schlaffer seien. Das nordische Klima hingegen bringe lebenstüchtigere Menschen hervor. „Solche Theorien zogen die Engländer als Legitimation für ihre Kolonialmacht heran“, sagt die Anglistin. Im Sommer zog die gesamte Kolonialverwaltung nach Simla, eine Ortschaft in den Vorbergen des Himalaja. Auf knapp 2.000 Metern waren die Temperaturen deutlich niedriger, und die Beamten kritzelten eifrig in ihre Tagebücher, wie „wohltuend englisch“ das Klima sei – mit kühlem Kopf lasse es sich endlich wieder anständig arbeiten.
Trotzdem waren die Briten auch für die Muße nicht unempfänglich, betont Masurczak. Die Beschreibungen Indiens und seiner Einheimischen schwankten stets zwischen der Aversion gegen die „nackten, schwarzen Kreaturen, die vor ihren Hütten hocken“, wie die Schriftstellerin Emily Eden in den 1830er Jahren notierte, und der Sehnsucht nach einem Leben fernab zivilisatorischer Zwänge: „Das genüssliche Rauchen der Wasserpfeife zum Beispiel“, berichtet Masurczak, „betrachteten viele Engländer noch im 18. Jahrhundert als eine verlorene Kulturtechnik, die sie selbst ausübten und mit der sie sich ein Stück an die fremde Welt herantasteten.“
Einatmen, ausatmen
Ob Hatha Yoga oder transzendentale Meditation: Der gestresste Großstadtwestler ahmt gerne fremde Kulturtechniken nach, mit denen er entschleunigen und entspannen kann. Doch lässt sich Muße etwa herbeimeditieren? Die Psychologin Minh Tam Luong schüttelt den Kopf: „Dem Einzelnen wird immer vermittelt, dass Stress ein individuelles Problem sei, das er beseitigen müsse: ‚Mach mal was, streng dich an, damit du im Wettbewerb mithalten kannst.‘ Dabei liegt der Stress häufig darin begründet, dass der Einzelne versucht, den äußeren Zwängen und Erwartungen gerecht zu werden.“ Und die werden immer üppiger.

81 Schüler absolvierten das Achtsamkeitstraining und konnten dadurch den Stress der Oberstufenzeit reduzieren. Foto: Gerhard Seybert/Fotolia
Luong schlug ihr Forschungszelt an einem Ort auf, der einst als „Raum der Muße“ galt: „schola“, das lateinische Wort für „Schule“. Dort hat sie sich mit der modernen Schwester der Muße – der Achtsamkeit – beschäftigt. Sie zu fassen sei nicht so einfach. „Man kann sie als Zustand, persönliche Eigenschaft oder als ein Programm definieren. Wesentlich ist dabei eine Haltung der Präsenz und Nichtwertung.“ Die Psychologin wollte herausfinden, ob Achtsamkeit Schülerinnen und Schülern dabei helfen kann, den Stress der Oberstufenzeit zu reduzieren. Acht Wochen lang erprobte sie mit 81 Elftklässlern von drei Freiburger Gymnasien das so genannte Mindfulness-Based-Stress-Reduction-Programm (MBSR), das der Achtsamkeitspionier Jon Kabat-Zinn Ende der 1970er Jahre entwickelt hatte. „Dabei war uns wichtig, dass es nicht darum ging, noch mehr Leistung zu erbringen. Stattdessen wollten wir die Jugendlichen dazu bewegen, mehr zu reflektieren: Was ist mir wichtig? Wie möchte ich lernen?“
Die Ergebnisse belegten die Wirksamkeit der Übungen, sagt Luong. Die Jugendlichen, die bei den „Muße-Kursen“ mitgemacht hatten, fühlten sich im Vergleich zu den anderen Mitschülern weniger ängstlich und gestresst – und das sogar als viele Klausuren und Tests anstanden. Auch ihre sozial-emotionalen Kompetenzen verbesserten sich. Das Achtsamkeitstraining sieht Luong „als eine Brücke, die zu Momenten der Muße führen kann. Für jemanden mit einem hohen Stresslevel ist das erst gar nicht möglich.“
Auf in die zweite Runde
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert den Sonderforschungsbereich 1015 „Muße. Grenzen, Raumzeitlichkeit, Praktiken“ mit knapp 6,5 Millionen Euro für die nächsten vier Jahre. Dies ist die zweite Runde, bei der der 2013 gestartete Forschungsverbund erfolgreich war. Er will mit neu hinzugekommenen Fächern insbesondere den Gegenwartsbezug der Muße stärken. Vertreten sind Disziplinen aus der Philologischen, Philosophischen, Theologischen, der Wirtschafts- und Verhaltenswissenschaftlichen Fakultät, der Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen sowie der Medizinischen Fakultät und dem Universitätsklinikum. Hinzu kommen das Rechenzentrum und die Universitätsbibliothek. Darüber hinaus wird ein Museum der Muße und Literatur in Baden-Baden aufgebaut. Sprecherin ist Prof. Dr. Elisabeth Cheauré vom Slavischen Seminar.
www.sfb1015.uni-freiburg.de