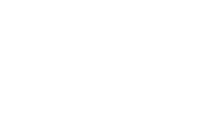Die angenehme Erschütterung
Freiburg, 15.06.2020
Nicht alle, die in der Wissenschaft tätig sind, bringen ihren Beruf spontan mit Muße in Verbindung – eher schon mit ihrem Gegenteil: rastlos forschen, eifrig publizieren, rührig Anträge für neue Projekte stellen. Dabei galt Muße in ihren antiken Anfängen, ausdrücklich bei Aristoteles, als Ursprung von Wissenschaft selbst. Seit 2013 untersuchen Forschende verschiedener Fakultäten der Universität Freiburg im Sonderforschungsbereich (SFB) Muße die Erscheinungsformen des „tätigen Untätigseins“ und den geschichtlichen Wandel der Muße bis heute. Ein Sonderheft des SFB-Magazins macht das Verhältnis von Muße und Wissenschaft zum Thema. Hans-Dieter Fronz hat sich mit fünf Freiburger Forscherinnen und Forschern, die Beiträge für die Ausgabe verfasst haben, über den Stellenwert der Muße für ihre Arbeit unterhalten – auch in Zeiten der Corona-Pandemie.

Der Philosoph Aristoteles, eine der Portalfiguren der Universität Freiburg, bezeichnete die Muße einst als Ursprung von Wissenschaft. Foto: Sandra Meyndt
 Für den Philosophen Dr. Jochen Gimmel (Foto: Jochen Gimmel) ist der Forschende „nach wie vor in einer sehr privilegierten Situation, auch in diesen Corona-Zeiten. Ich kann wunderbar von zu Hause aus arbeiten, zumal ich momentan keinen Lehrauftrag habe.“ Andererseits sieht er für Forschende aktuell durchaus einen erheblichen Mehraufwand in der technischen Herausforderung, den Lehrbetrieb aufrechtzuerhalten und trotz der erzwungenen Distanz gleichzeitig Ansprechperson für die Studierenden zu bleiben: „Man kann wirklich nicht sagen, dass die Mußefreiräume gewachsen sind.“
Für den Philosophen Dr. Jochen Gimmel (Foto: Jochen Gimmel) ist der Forschende „nach wie vor in einer sehr privilegierten Situation, auch in diesen Corona-Zeiten. Ich kann wunderbar von zu Hause aus arbeiten, zumal ich momentan keinen Lehrauftrag habe.“ Andererseits sieht er für Forschende aktuell durchaus einen erheblichen Mehraufwand in der technischen Herausforderung, den Lehrbetrieb aufrechtzuerhalten und trotz der erzwungenen Distanz gleichzeitig Ansprechperson für die Studierenden zu bleiben: „Man kann wirklich nicht sagen, dass die Mußefreiräume gewachsen sind.“
In der Arbeit am SFB sucht der Postdoc, das „kritische Potenzial des Mußebegriffs“ für die Wissenschaften philosophisch fruchtbar zu machen. So setzt er dem Effizienzdenken einer durchökonomisierten Wissenschaft die Muße als „Selbstzweckhaftigkeit“ von Forschung entgegen. Mit dem Philosophen Theodor W. Adorno spricht er von der Wissenschaft als dem „Glück der Erkenntnis“; sie sei ein potenzieller Freiraum fruchtbaren „gedanklichen Abschweifens“. Über der Arbeit am SFB sei ihm klar geworden, „wie wenig Gelegenheit zur Muße die Wissenschaft heute eigentlich bietet“. Und wie wichtig es deshalb sei, sich gegenüber ihren Produktivitätszwängen selbst Mußefreiräume zu schaffen.
 Hat sich die Fremdbestimmung des Forschenden in der Wissenschaft in den vergangenen Jahrzehnten verschärft? „Schwer zu sagen“, meint Prof. Dr. Anja Göritz (Foto: Anja Göritz), die die Abteilung für Wirtschaftspsychologie leitet. Von Muße und Ruhe hätte sie „gern mehr. Tiefes Nachdenken profitiert von Ruhe, und die kommt in meiner Arbeit leider deutlich zu kurz.“ Dennoch bezeichnet sie ihre wissenschaftliche Tätigkeit als eine „Quelle großer Befriedigung“. Die Anforderungen durch die Corona-Krise empfindet sie zunächst als Zwang. Doch könnten nach ihrer Einschätzung die notwendig gewordenen Änderungen für die Art und Weise, wie Forschende arbeiten und leben, auf längere Sicht auch eine „Chance zur Neuorientierung“ bieten.
Hat sich die Fremdbestimmung des Forschenden in der Wissenschaft in den vergangenen Jahrzehnten verschärft? „Schwer zu sagen“, meint Prof. Dr. Anja Göritz (Foto: Anja Göritz), die die Abteilung für Wirtschaftspsychologie leitet. Von Muße und Ruhe hätte sie „gern mehr. Tiefes Nachdenken profitiert von Ruhe, und die kommt in meiner Arbeit leider deutlich zu kurz.“ Dennoch bezeichnet sie ihre wissenschaftliche Tätigkeit als eine „Quelle großer Befriedigung“. Die Anforderungen durch die Corona-Krise empfindet sie zunächst als Zwang. Doch könnten nach ihrer Einschätzung die notwendig gewordenen Änderungen für die Art und Weise, wie Forschende arbeiten und leben, auf längere Sicht auch eine „Chance zur Neuorientierung“ bieten.
Dem Streben von Wissenschaft nach „Erkenntnis um der Erkenntnis willen“ läuft für Anja Göritz das Ringen um „Aufmerksamkeit, Reputation und Forschungsmittel“ zuwider. Die Teilnahme an der Arbeitsgemeinschaft „Muße und Wissenschaft“ im SFB erlebte sie als „angenehme Erschütterung“ und „enorm bereichernd“ im Sinne des Hinausblickens über den Tellerrand des eigenen Fachs.
 Dr. Andreas Kirchner (Foto: Andreas Kirchner) arbeitet als Postdoc im SFB. Bereits in seiner Dissertation beschäftigte er sich mit „Muße und Theoria in der spätantiken Philosophie und Theologie“. Hat Muße noch ihren Platz in der Wissenschaft? „In kleinen Lichtmomenten: ja“, antwortet er spontan. Doch dann erinnert er sich an die Zeit seiner Dissertation. „Wo es mir gelang, mich frei zu halten von den Zwängen und prekären Vereinnahmungen fühlte ich mich unheimlich privilegiert darin, dass ich mich mit Dingen beschäftigen konnte, die mich erfüllten. Diese Arbeit wurde dann manchmal auch Muße.“
Dr. Andreas Kirchner (Foto: Andreas Kirchner) arbeitet als Postdoc im SFB. Bereits in seiner Dissertation beschäftigte er sich mit „Muße und Theoria in der spätantiken Philosophie und Theologie“. Hat Muße noch ihren Platz in der Wissenschaft? „In kleinen Lichtmomenten: ja“, antwortet er spontan. Doch dann erinnert er sich an die Zeit seiner Dissertation. „Wo es mir gelang, mich frei zu halten von den Zwängen und prekären Vereinnahmungen fühlte ich mich unheimlich privilegiert darin, dass ich mich mit Dingen beschäftigen konnte, die mich erfüllten. Diese Arbeit wurde dann manchmal auch Muße.“
Nach Kirchners Verständnis braucht der Forschende immer wieder den Freiraum und die Möglichkeit, „innezuhalten und Abstand von seiner Arbeit zu haben, um so einen neuen Blick auf das, womit er sich gerade beschäftigt, zu gewinnen“. Kritik an der Wissenschaft in ihrer gegenwärtigen Form ist für ihn nicht destruktiv, sie kann durchaus produktiv sein. Doch dazu müssen die Produktivitätskriterien und Leistungsparadigmen der Gegenwart selbst problematisiert werden. Eben dies hat er in seiner Arbeit im SFB über das Verhältnis von Wissenschaft und Muße gelernt: dass Freiheit und Muße in der Wissenschaft eine andere Form von Produktivität fördern können.
 Im Rückbezug auf die Sozialwissenschaftlerin Prof. Dr. Christina Thürmer-Rohr und die Literaturwissenschaftlerin bell hooks ist für Dr. Marion Mangelsdorf (Foto: Katja Harbi) der Dialog ein Element von Wissenschaft, das sich mit Muße in Verbindung bringen lässt. „Der Dialog ist etwas, das nicht in abgeschlossenen Formen denkt, sondern Gedanken im Verlauf eines Gesprächs entwickeln lässt“, sagt die Kulturwissenschaftlerin. Er steht darin quer zum „schwindelerregenden Leistungsdruck“ eines „akademischen Kapitalismus“, von dem sie in einem gemeinsam mit Doris Ingrisch verfassten Text berichtet.
Im Rückbezug auf die Sozialwissenschaftlerin Prof. Dr. Christina Thürmer-Rohr und die Literaturwissenschaftlerin bell hooks ist für Dr. Marion Mangelsdorf (Foto: Katja Harbi) der Dialog ein Element von Wissenschaft, das sich mit Muße in Verbindung bringen lässt. „Der Dialog ist etwas, das nicht in abgeschlossenen Formen denkt, sondern Gedanken im Verlauf eines Gesprächs entwickeln lässt“, sagt die Kulturwissenschaftlerin. Er steht darin quer zum „schwindelerregenden Leistungsdruck“ eines „akademischen Kapitalismus“, von dem sie in einem gemeinsam mit Doris Ingrisch verfassten Text berichtet.
Ein Paradebeispiel von dialogischer Erkenntnissuche ist für Marion Mangelsdorf Platons „Gastmahl“. Funktioniert Muße für sie auch im wissenschaftlichen Alleingang? „Ja, aber dann gewissermaßen in Gestalt eines kritischen inneren Dialogs.“ Beide Formen erscheinen ihr gerade in den aktuellen, herausfordernden Zeiten von Corona sinnvoll. Zumal der interdisziplinäre Dialog, wie sie ihn in „sehr guten Gesprächen“ im SFB vor allem in einer Arbeitsgruppe zum Thema „Muße und Wissenschaft“ erlebte, für sie eine Möglichkeit ist, aus dem Hamsterrad des nützlichkeitsorientierten Wissenschaftsbetriebs auszusteigen. Dass dies überhaupt möglich sei, verbucht sie als neue Erfahrung und Gewinn für sich.
 Als Slavistin und Osteuropahistorikerin sieht sich Dr. Regine Nohejl (Foto: Regine Nohejl) in der „vorteilhaften Lage, auf einer Grenze zu stehen: zu Kulturen, die in Westeuropa nicht ganz fremd, aber auch nicht ganz vertraut sind.“ In einer solchen Position weitet sich nach ihrer Erfahrung „automatisch der Blick, und man wird sensibel für das Andere und den Umgang mit ihm“ – ein Vorgang emotionaler Öffnung, der für sie mit Muße zu tun hat. Ein Beispiel dafür, wie ein „mußeaffiner Umgang mit Themen“ den interkulturellen Dialog befördern kann, ist für sie der Umstand, dass eine im SFB erarbeitete Ausstellung über den Schriftsteller Ivan Turgenev in Baden-Baden auch in Russland gezeigt werden wird.
Als Slavistin und Osteuropahistorikerin sieht sich Dr. Regine Nohejl (Foto: Regine Nohejl) in der „vorteilhaften Lage, auf einer Grenze zu stehen: zu Kulturen, die in Westeuropa nicht ganz fremd, aber auch nicht ganz vertraut sind.“ In einer solchen Position weitet sich nach ihrer Erfahrung „automatisch der Blick, und man wird sensibel für das Andere und den Umgang mit ihm“ – ein Vorgang emotionaler Öffnung, der für sie mit Muße zu tun hat. Ein Beispiel dafür, wie ein „mußeaffiner Umgang mit Themen“ den interkulturellen Dialog befördern kann, ist für sie der Umstand, dass eine im SFB erarbeitete Ausstellung über den Schriftsteller Ivan Turgenev in Baden-Baden auch in Russland gezeigt werden wird.
Dass die Corona-bedingte „erzwungene Muße“ die Wahrnehmung der Menschen beeinflusse, steht für Regine Nohejl außer Frage. Sie selbst hat – ganz dem Forschungsgegenstand des SFB gemäß ‒ in ihrer Arbeit trotz des großen Pensums zu einer gewissen inneren Ruhe gefunden, wie sie erklärt. Und dabei gleichzeitig ein Bewusstsein für den Widerspruch entwickelt, in dem das Erkenntnisinteresse des SFB zum konventionellen Wissenschaftsbetrieb steht. Dass sie wieder für ihre Arbeit „brennt“, ist für sie eine beglückende Erfahrung.
Sonderforschungsbereich „Muße. Grenzen, Raumzeitlichkeit, Praktiken“