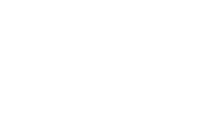Bewegung!
Freiburg, 06.09.2018
Der Pariser Mai, die Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg, die Schüsse auf Rudi Dutschke: Das Jahr 1968 gilt als Höhepunkt einer studentischen Revolte, die in den 1960er und 1970er Jahren die Welt veränderte. Doch wie ging dieser Wandel vonstatten, und wie tief greifend war er? Fünfzig Jahre später gibt es darüber verschiedene Ansichten. Mathias Heybrock hat Freiburger Forscherinnen und Forscher gebeten, die Wirkung der 68er zu skizzieren – ein Gedankenmosaik aus unterschiedlichen Disziplinen.

Nicht wenige der 1968 protestierenden Studierenden wurden später Lehrer – und brachten neue pädagogische Konzepte und Inhalte an die Schulen. Illustration: Svenja Kirsch
Tomatenwurf und Weiberräte
Redet man über 1968, steht der Generationenkonflikt im Vordergrund: die Distanzierung von den vom Faschismus geprägten Eltern, die Auseinandersetzung mit den Strukturen einer rigiden Nachkriegsgesellschaft. „Das stimmt auch zu einem guten Teil“, sagt die Soziologin Prof. Dr. Nina Degele. „Doch mindestens ebenso wichtig ist der Wandel der Geschlechterverhältnisse. Und da kommt der berühmte Tomatenwurf ins Spiel.“
In den 1960er Jahren war das Rollenverständnis noch sehr traditionell, selbst unter Studierenden. „Man war nicht einfach zusammen, sondern verheiratet“, sagt Degele. Haushalt und Erziehung der Kinder blieben größtenteils Frauensache. Im SDS, dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund, der den 68er-Protest prägte, waren natürlich auch Frauen organisiert. „Aber sie blieben häufig im Hintergrund, durften Kaffee kochen und Flugblätter verteilen.“ Bis Helke Sander, Delegierte des Aktionsrats zur Befreiung der Frauen, auf einer SDS-Konferenz im September 1968 in Frankfurt eine Rede gegen den Status der Frauen als „Putzfrauen der Revolution“ hielt, wie Degele es formuliert. Als der SDSler Hans-Jürgen Krahl ohne Diskussion zur Tagesordnung übergehen wollte, bewarf die Studentin Sigrid Rüger ihn mit Tomaten. „Das löste eine Menge aus“, betont Degele. Die Frauen gründeten so genannte Weiberräte, Kinderläden entstanden, auch selbstverwaltete Frauenbuchläden, zu denen Männer keinen Zutritt hatten. Im Kampf für selbstbestimmte Sexualität und gegen den Abtreibungsparagrafen 218 war das Jahr 1971 der nächste Meilenstein: „Die von Alice Schwarzer organisierte Aktion ‚Wir haben abgetrieben‘ in der Zeitschrift ‚Stern‘ war dabei ganz wichtig.“
„Die Macht der Schwänze hat ihre Grenze“ konnte man damals bei Demonstrationen auf Plakaten lesen. „Das war teils ziemlich massiv – für viele Männer bestimmt ein Schock“, konstatiert Degele. Für sie hat die Soziologin durchaus Verständnis: „Die Männer waren so fokussiert auf die gesellschaftliche Ebene – das Persönliche als politisch zu denken hat sie überfordert.“ Nur widerwillig begannen sie, die eigenen Rollen sowie das Geschlechterverhältnis zu überdenken. Immerhin – sie begannen. Die Frauenbewegung zeigte eine nachhaltige Wirkung: „Dass wir heute Gleichstellungsbeauftragte in den Rathäusern haben, dass an den Universitäten Gender Studies möglich sind – das ist klar ein Effekt der Frauenbewegung.“

Komödien waren beliebt, bei politisch engagierten Filmen blieb das Publikum aus: Die Verkaufszahlen an den Kinokassen geben Aufschluss über die Präferenzen einer Gesellschaft. Foto: Krists Luhaers/Unsplash
Molotowcocktail auf der Leinwand
Wenn sie von 1968 spricht, empfiehlt Prof. Dr. Robin Curtis zunächst einen Blick auf das Box Office. In Deutschland landete in diesem Jahr der US-Trickfilm „Das Dschungelbuch“ auf Platz eins. Es folgten die Komödie „Zur Sache, Schätzchen“ sowie „Das Wunder der Liebe“, ein „Aufklärungsfilm“ von Oswalt Kolle. Zwei Dinge findet die Direktorin des Instituts für Medienkulturwissenschaft daran interessant: Erstens, dass die Leute damals gern deutsche Filme schauten, mehr als heute. Zweitens, dass Unterhaltung dominierte: „Es gab ja auch den feministischen Film ‚Neun Leben hat die Katze‘ oder etwas später den Film ‚Rote Sonne‘. In solch politisch engagierte Filme ist das Publikum allerdings nicht massenhaft geströmt.“ Doch auch das Unterhaltungs- und Genrekino vermag seine Zeit zu spiegeln. Die flotte Komödie „Zur Sache, Schätzchen“ zeichnete als erster deutscher Film das Bild eines nicht bürgerlichen Lebensstils. In den USA landeten 1968 der Science-Fiction-Film „Planet of the Apes“ sowie der Horrorfilm „Night of the Living Dead“ in den Top Ten. „Beide haben deutliche Bezüge zur schwarzen Bürgerrechtsbewegung“, betont Curtis.
Revolutionäre Filme seien in Westdeutschland vor allem an der 1966 gegründeten Berliner Film- und Fernsehakademie entstanden. „Die Ausbildung dort war antihierarchisch. Alle lernten alles, also nicht nur Regie, sondern auch Kamera, Schnitt, Ton. An eine kommerzielle Auswertung fürs Kino hat niemand gedacht.“ Zu den Studierenden gehörte Holger Meins, der an dem dreiminütigen Kurzfilm „Wie baue ich einen Molotowcocktail?“ beteiligt war – und 1970 zur RAF ging. „Die Idee war, frei nach Jean-Luc Godard, in etwa: Ein radikaler Filmemacher ist derjenige, der aufhört, ein Filmemacher zu sein.“
Curtis findet es wichtig, die 68er-Bewegung aus heutiger Perspektive nicht zu verklären. Sie verweist zum Beispiel auf den Anteil von Frauen in der Filmbranche. „Natürlich gab es damals auch Regisseurinnen.“ Dazu zählten etwa Ulla Stöckl und May Spils. „Aber ihre Zahl ist seitdem keineswegs gestiegen. Wir sollten das Veränderungspotenzial der Epoche nicht zu hoch bewerten.“ Schon das Genrekino jener Jahre sei in dieser Hinsicht eher skeptisch gewesen. In „Night of the Living Dead“ ist der einzige Überlebende des Angriffs der Untoten ein Schwarzer. Zum Schluss wird er von der Polizei erschossen.
Protest ist nicht automatisch links
Protestkultur ist heute ein fester Bestandteil der Gesellschaft: „Sie ist sehr präsent und stößt viele Diskussionen an“, sagt die Historikerin Dr. Birgit Metzger. Allerdings ist die Protestkultur weniger dynamisch als noch in den 1960er Jahren. „1968 ist ja eine Chiffre für Veränderungsprozesse, die über einen längeren Zeitraum stattfanden.“ Damals waren es zunächst die Studierenden, die auf die Straße gingen. Der 2. Juni 1967 war ein wichtiges Datum: Bei einer Demonstration in Westberlin erschoss der Polizist Karl-Heinz Kurras den damals 26-jährigen Benno Ohnesorg. „Das sorgte für eine starke Mobilisierung, auch eine Radikalisierung“, berichtet die Forscherin. Gefragt wurde nun auch, ob Gewalt ein legitimes Mittel des Protests sei. Den Weg der späteren RAF, politisch motivierte Morde zu begehen, unterstützte aber nur eine Minderheit. Die bürgerliche Gesellschaft hingegen empfand Protestformen, die heutzutage harmlos erscheinen, bereits als gewalttätig und reagierte oft scharf: Auf einen Sitzstreik 1966 in Hamburg antwortete die Polizei mit Wasserwerfern und Knüppeln.

Psychodelischer Bandauftritt: Mit der Musik zum Film „Magical Mystery Tour“ landeten die Beatles Ende der 1960er Jahre auf den ersten Plätzen in den britischen und US-amerikanischen Hitparaden. Foto: Parlophone Music Sweden via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Drei Elemente machen für Metzger die Protestkultur aus. Da ist zunächst deren rationale Seite, wie sie sich etwa auf einer politischen Demonstration zeigt: Transparente und Ansprachen formulieren Forderungen und Argumente. Daneben gibt es auch eine spielerische, kreative Komponente. Heute sei sie zum Beispiel in den Flashmobs, die urplötzlich in den Alltag der Leute platzen und sie mit witzigen Aktionen zum Nachdenken bewegen wollen, zu beobachten. Drittens findet Metzger das Ineinandergreifen von Protest- und Gegenkultur elementar. „Man protestiert nicht nur, sondern handelt, schafft sich eigene, alternative Lebenswelten.“ Als Beispiel nennt sie die Kinderläden und die sozialen Bewegungen der 1970er Jahre.
Gegenwärtig sei der Protest heterogen und diversifiziert, auch durch die neuen medialen Möglichkeiten. „Dabei ist er längst nicht automatisch links, liberal, antiautoritär. Er ist auch konservativ oder sogar rechtsradikal. Vor etwa 15 Jahren hat sich das gewandelt.“ Die Historikerin erinnert an die rechte Bewegung der „Autonomen Nationalisten“, die damals von den linken Autonomen den Kapuzenpulli und den chaotischen Organisationsstil übernahm, um gezielt Jugendliche anzusprechen, die die politischen Inhalte der NPD gut fanden, mit ihrer Ästhetik aber nichts anfangen konnten.
Die Band betritt die Bühne der Welt
Die Musik der 68er? „Das fing ja schon viel früher an“, sagt Dr. Knut Holtsträter vom Zentrum für Populäre Kultur und Musik. Er nennt 1964 als wichtiges Jahr: Bei der „British Invasion“ stürmten die Beatles und die Rolling Stones die Hitparaden in den USA und ließen das Publikum in ekstatische Zuckungen verfallen, die Elvis Presley hüftlahm erscheinen ließen. „Und dann ist es innerhalb kürzester Zeit explodiert“, fasst der Musikwissenschaftler zusammen: Die Band „Grateful Dead“ gründete sich 1965, zwei Jahre später erschien Jimi Hendrix’ Debütalbum „Are You Experienced“. 1968 schließlich erreichte die Hippiebewegung im Sommer der Liebe ihren Höhepunkt, und die Bands ließen sich kaum noch zählen. Ihre Musik war psychedelisch und erlaubte Rausch- und andere aufregende Körpererfahrungen: „Das war neu, das gab es vorher nicht – eine ganze Masse von jungen Leuten konnte sich darin wiederfinden.“ Auch politisch sei Musik vorher nicht gewesen, präzisiert Holtsträter: „Die Songs in den Charts verhandelten vormals nur das Private. Es war unerhört, dass man Stellung gegen den Krieg, die Diskriminierung von Frauen oder Schwarzen bezog.“
Musik beeinflusste und spiegelte das Lebensgefühl der 68er wider. Sie wirkte aber auch ganz konkret in die Gesellschaft: „Der neue Musikstil veränderte den Musikmarkt“, so Holtsträter. Vorher dominierte die Single. Nun machte sich die LP mit teilweise sehr langen Stücken breit. Erste Konzeptalben erschienen, die nicht den einzelnen Hit, sondern das Gesamtkunstwerk in den Vordergrund rückten. Von einer reinen Gegenkultur könne man jedoch schon deswegen nicht sprechen, weil diese Platten von den Giganten der Unterhaltungsindustrie vertrieben wurden. Sie versprachen ein gutes Geschäft, wurden viel und überall gekauft. Auch in Deutschland, wo man die gleiche Musik hörte wie in den USA – mit nationalen Besonderheiten: „Bei uns entwickelten Bands wie Amon Düül den Krautrock, der später wiederum international ausstrahlte.“

„Respect all Women“: Mit Transparenten bringt eine protestierende Gruppe ihre Forderungen und Argumente zum Ausdruck. Foto: T.Chick Mcclure/Unsplash
Was ist davon geblieben? „Die Politisierung der populären Musik, ganz klar“, hebt der Forscher hervor. Fast noch wichtiger ist ihm aber die Entstehung erster Bands: „Vorher war Musik hierarchisch: Orchester hatten Dirigenten, Einzelinterpreten beschäftigten Begleitmusiker im Angestelltenstatus. Mit der Band gab es jetzt plötzlich das Kollektiv, in dem jedes Mitglied wichtig war.“ Freilich entstanden auch in diesen Gruppen immer wieder Hierarchien. „Aber es war doch eine neue und freiere Organisationsform, die aus der Musik nicht mehr wegzudenken ist.“
Geschichte ins Klassenzimmer bringen
Prof. Dr. Sylvia Paletschek steht auf und holt ein Buch an den Tisch: „Entdecken und verstehen“ – ein Lehrbuch für den Geschichtsunterricht an Schulen. „Der Autor ist Thomas Berger von der Heide“, erläutert die Historikerin. 1968 war er Student in Freiburg und Mitglied der Grundordnungsversammlung, die eine neue „Verfassung“ für die Universität erarbeiten sollte. Im Ringen um eine Bildungsreform war Freiburg schon vor 1968 ein wichtiges Zentrum. 1965 wurde die bundesweite „Aktion Bildungsnotstand“ von hier aus organisiert. Der Pädagoge Georg Picht, Direktor der Privatschule Birklehof bei Hinterzarten, veröffentlichte bereits 1964 seine Streitschrift „Die deutsche Bildungskatastrophe“, die einen großen Nachhall hatte. „Daran sieht man: Die Studierenden waren nicht die Einzigen, die mit der Bildungspolitik unzufrieden waren“, sagt der Soziologe Prof. Dr. Ulrich Bröckling. Aufgrund der stark gestiegenen Studierendenzahlen sahen auch staatliche Stellen massiven Änderungsbedarf. Nur: Wie sollte die Reform aussehen? Und wie weit konnte die studentische Mitbestimmung dabei gehen? „Über solche Fragen kam es dann bei den Protesten von 1968 zum offenen Streit.“
Die Ordinarien sahen die Freiheit von Forschung und Lehre bedroht. Auch wollten sie sich nicht dem Druck der Studierenden und ihren Forderungen nach Mitbestimmung beugen. Die Drittelparität, also die ausgewogene Besetzung der universitären Gremien mit Professoren, Mittelbau und Studierenden, forderte dabei nicht nur der radikale Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS), sondern etwa auch der konservative Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS). Die Stimmung war aufgeladen, teils aggressiv. „Die hitzigen Debatten jedoch hinterließen bei den Leuten auch das Gefühl: Ich habe Einfluss, ich kann Transformationsprozesse anstoßen“, sagt Paletschek.
Nicht wenige der damals protestierenden Studierenden wurden später Lehrerinnen und Lehrer – und brachten neue pädagogische Konzepte und Inhalte an ihre Schulen, die sie nach 1968 zunächst an den Universitäten erprobt hatten. „Manche dieser Lehrer konzipierten dann sogar Schulbücher“, sagt Paletschek – wie Thomas Berger von der Heide. Sie hatten die Erfahrung gemacht, dass man Geschichte ändern kann – und auch die Methoden des Geschichtsunterrichts in der Schule.