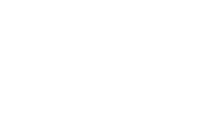„Es reicht nicht, nur zu informieren“
Freiburg, 17.01.2020
Glaubt man Umfragen, sind 84 Prozent der Deutschen zur Organspende bereit – einen Organspendeausweis haben aber nur 33 Prozent, tatsächlich gespendet werden so wenige Organe, dass die Politik nun um gesetzliche Lösungen ringt: Gerade hat der Bundestag einen Gesetzesentwurf von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn abgelehnt, der die so genannte Widerspruchslösung vorsah. Dieser zufolge hätte jeder Mensch als potenzielle Organspenderin oder potenzieller Organspender gegolten, wenn er oder sie nicht zu Lebzeiten widerspricht. Stattdessen wurde beschlossen, die Zustimmungslösung zu intensivieren. Dr. Klaus Michael Lücking, Kinderarzt und Ärztlicher Koordinator für Organspende des Universitätsklinikums Freiburg, erläutert im Gespräch mit Jürgen Reuß, welche Aspekte er beim Thema Organspende für zentral hält.
 Der Deutsche Bundestag hat über die gesetzliche Neuregelung zur Organspende entschieden. Der Organspendeausweis hat noch nicht ausgedient, wird aber durch ein Online-Register ergänzt werden. Foto: Alexander Raths/stock.adobe.com
Der Deutsche Bundestag hat über die gesetzliche Neuregelung zur Organspende entschieden. Der Organspendeausweis hat noch nicht ausgedient, wird aber durch ein Online-Register ergänzt werden. Foto: Alexander Raths/stock.adobe.com
Herr Lücking, wenn man den Umfragezahlen glaubt, finden vier Fünftel der Deutschen Organspende gut, aber nur ein Drittel der Bevölkerung hat einen Organspendeausweis. Wie erleben Sie das in der Praxis?
Klaus Michael Lücking: Da ist die Diskrepanz noch viel ausgeprägter. Von den Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation, bei denen wir mit Angehörigen über Organspende reden müssen, haben unter fünf Prozent einen Organspendeausweis oder eine Patientenverfügung.
Warum?
Eine Entscheidung darüber zu treffen bedeutet, sich mit der Frage des eigenen Todes, der eigenen Endlichkeit zu beschäftigen. Das ist für die meisten Menschen altersunabhängig ein emotional belastendes Thema. Ich habe Verständnis dafür, dass Menschen das sehr schwerfällt.
Wie kommt man trotzdem zu einer Entscheidung?
Wie bei jeder guten Entscheidung bedarf es einer Abwägung sowohl der rationalen Argumente als auch der emotionalen Empfindungen. Wir als Gemeinwesen, als Staat fordern die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, ihre Organe zu spenden – da sollten wir auch dazu beitragen, dass Räume für Gespräche, Nachfragen und Beratung entstehen. Es braucht ein kompetentes Gegenüber – es reicht nicht, nur zu informieren.
Welche Aspekte sollten Ihrer Erfahrung nach unbedingt angesprochen werden?
Vorweg gibt es einen ganz entscheidenden Aspekt: Kein Mensch kommt als Organspender in die Klinik. Jeder Mensch, der hier in den Schockraum und auf die Intensivstation gebracht wird, kommt als Patient, dem wir primär helfen wollen. Es ist unser Auftrag, primär alles zu tun, um den Patienten zu retten, wenn er dies wünscht. Erst wenn da keine Hoffnung mehr besteht, dürfen und müssen wir neben der Beendigung der Intensivtherapie auch über Organspende nachdenken und darüber ergebnisoffen sprechen.
Was wäre sinnvoll, um sich schon zu Lebzeiten oder als Angehöriger auf solche Entscheidungsfindungen vorzubereiten?
Es gibt viele gute Informationsbroschüren. Aber es gibt wenig Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, zu denen Sie gehen können, um über Ihre Fragen, Ihr Unbehagen, Ihre Sorgen wirklich offen zu reden. Da besteht Bedarf. Das können Hausärztinnen und -ärzte sein, wenn sie entsprechend geschult und finanziert werden. Sie wären gute Ansprechpartner – nicht nur für die Organspende, sondern überhaupt bei Entscheidungen, die mit dem Ende des Lebens zusammenhängen wie Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht.
Als tot gilt ein Mensch mit dem Hirntod. Dieser ist von außen nicht sichtbar, während das Herz noch sichtbar schlägt. Ist das vielen womöglich unheimlich?
Tod oder Leben haben die unterschiedlichsten Dimensionen – naturwissenschaftliche, ethische, religiöse, spirituelle. Trotzdem wird von vielen Fachleuten der Ethik und Philosophie, auch vom Deutschen Ethikrat, der Hirntod als Tod des Menschen akzeptiert. Spannend ist, dass im Votum des Deutschen Ethikrates auch ein Minderheitsvotum zugelassen wurde, in dem Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Arbeitsfelder sagen: Nein, für uns ist der Hirntod nicht der Tod des Menschen, sondern ein Point of no return im Sterbeprozess – ein Moment, der zwar unumkehrbar ist, aber es wäre willkürlich, diesen Punkt als endgültigen Tod festzulegen. Wir halten aber trotzdem den Hirntod für so schwerwiegend, dass wir ab diesem Zeitpunkt einer Organspende zustimmen würden. Die Bundesärztekammer hat aus gutem Grund die Hirntodrichtlinie überarbeitet und spricht in der aktuellen Neuauflage nicht mehr vom Hirntod, sondern vom irreversiblen Funktionsausfall des gesamten Gehirns.
 „Nicht alles, was die Medizin anbieten kann, muss vom Patienten gewünscht sein“, betont Klaus Michael Lücking. Foto: Harald Neumann
„Nicht alles, was die Medizin anbieten kann, muss vom Patienten gewünscht sein“, betont Klaus Michael Lücking. Foto: Harald Neumann
Bleibt nicht trotzdem ein gewisses Unbehagen?
Ja, gerade auch innerhalb der medizinischen Profession. Einer Umfrage von 2014 zufolge geben 20 Prozent des Klinikteams an, mit dem Hirntodkonzept Probleme zu haben. Dieses Unbehagen wabert in den Köpfen: Die Menschen wissen zwar, was der Hirntod bedeutet, aber sie nehmen den Patienten nicht zwingend als tot wahr. Auf dem Organspendeausweis steht: „Nach meinem Tod…“. Die meisten Menschen verstehen darunter: ‚Wenn ich nicht mehr atme, wenn mein Herz aufhört zu schlagen‘. Ich habe mehrfach erlebt, dass nach öffentlichen Gesprächen über die Konzepte, die der Hirntoddefinition zugrunde liegen, Menschen zu mir kamen und sagten: „Jetzt muss ich Ihnen den Organspendeausweis zurückgeben. Ich habe gedacht, ‚tot‘ heißt, wenn ich ‚richtig tot‘ bin.“
Wären Sie dankbar dafür gewesen, wenn der Bundestag der doppelten Widerspruchslösung zugestimmt hätte, sodass durch den Wegfall der Zustimmungspflicht schwierige Gespräche mit Angehörigen minimiert worden wären?
Nein, ich würde auch weiterhin mit Angehörigen reden. In der Medizin ist die Einsicht zur Patientenautonomie gewachsen, der auch ich mich immer verpflichtet gefühlt habe: Nicht alles, was die Medizin anbieten kann, muss vom Patienten gewünscht sein. Bestimmte Eingriffe sind nicht möglich, wenn der Patient nicht zustimmt. Es war ein langer Weg von der paternalistischen Attitüde, der Arzt weiß, was für den Patienten gut ist, hin zur Einbindung der Patienten. Es wäre ein Paradigmenwechsel, wenn die Einführung einer Widerspruchslösung unterstellt, dass Schweigen die Zustimmung zu einer relevanten medizinischen Maßnahme wird. In der aktuellen Diskussion wird die Organspende meines Erachtens ohnehin zu sehr auf die Frage der gesetzlichen Regelung eingeengt.
Welche Faktoren sind noch wichtig?
Die Struktur des Organspendesystems, die Ressourcen in den Krankenhäusern, die Organspende ermöglichen sollen – oder neue Wege wie die Organspende nach Beendigung der Intensivtherapie und Herzstillstand. In Großbritannien werden 40 Prozent der Organe so gespendet. Und noch eins ist sehr wichtig: Wir machen uns zu wenig einen Kopf über Ärzte und Pflegepersonal, die Patienten zunächst mit einer kurativen Prognose betreuen und dann die Intensivmedizin für die Organspende fortsetzen müssen. Bei der Organentnahme scheint ein Patient auf dem OP-Tisch zu sterben, was in anderen Zusammenhängen immer der GAU ist. Das wird emotional nicht unbedingt einfacher, weil zuvor der Hirntod festgestellt wurde. Auch wir Ärzte und Pflegende haben Empfindungen, danach fragt häufig niemand. Ein klar geäußerter oder durch Angehörige hinreichend erklärter Wille des Patienten ist sehr wichtig, um mit dieser belastenden Situation adäquat umgehen zu können.