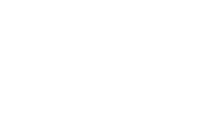Das Leid der Anderen
Freiburg, 05.06.2019
Die Historikerin Prof. Dr. Cornelia Brink interessiert sich für die Geschichte der Fotografie des 20. Jahrhunderts und die Geschlechterfrage im Journalismus. In einem neuen Projekt unter dem Dach des Sonderforschungsbereichs 948 „Helden, Heroisierungen, Heroismen“ vereint die Freiburger Wissenschaftlerin diese Themen und beschäftigt sich mit Kriegsfotografinnen. Lara Wehler hat Brink gefragt, wie sich das männlich geprägte Heldenbild im Arbeitsfeld Krisenjournalismus, in das zunehmend Frauen drängen, verändert hat.

Schicke Schuhe und eine Schusswaffe: Gerda Taros Foto „Republikanische Milizionärin bei der Ausbildung am Strand bei Barcelona“ aus dem Jahr 1936 vereint Gegensätze. Quelle: International Center of Photography, New York
Frau Brink, was charakterisiert die besondere Rolle der Kriegsfotografinnen?
Cornelia Brink: Es handelt sich um Frauen, die seit Anfang des 20. Jahrhunderts in ein männlich geprägtes Berufsfeld, den Kriegsjournalismus, eintreten. Diese Fotografinnen – und auch ihre männlichen Kollegen – werden bis heute mit der Idee einer besonderen Maskulinität und einem damit verbundenen Heldenbild konfrontiert. Ich erforsche für die Zeit seit dem Vietnamkrieg, wie Kriegsfotografinnen und auch Kriegsfotografen sich zu diesem Ideal positionieren, das seit einiger Zeit deutliche Risse zeigt. Außerdem interessiert mich, wie sie eigene Heldinnentypen erschaffen und ob es unter den früheren Fotografinnen Vorbilder dafür gibt.
Wie hat sich der Beruf der Kriegsfotografin entwickelt?
Ihre Anfänge hatten die Kriegsfotografinnen im Ersten Weltkrieg. Das waren jedoch kaum professionelle Fotografinnen, sondern mit Kameras ausgestattete Krankenschwestern. Mitte des 20. Jahrhunderts gab es eine relativ große Zahl an Kriegsfotografinnen, vor allem bei den US-amerikanischen Streitkräften. Allerdings sind nur sehr wenige dieser Frauen bekannt geworden. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg waren Kriegsfotografinnen im Auftrag großer Magazine unterwegs, beispielsweise im Vietnamkrieg. Aktuell gibt es wieder eine Veränderung in diesem Berufsfeld. Festanstellungen bei Zeitungen und Agenturen sind seltener geworden, der Zugang zum Kriegsgebiet ist strikter reglementiert, und die Kriege selbst sind unübersichtlicher. Hinzu kommt, dass der Anteil von Frauen im Kriegsjournalismus zugenommen hat, auch wenn er weiter relativ gering ist. Bei Soldatinnen ist das Arbeitsfeld ähnlich: eine sozial homogene Gruppe, die es nicht gewohnt ist, dass Frauen dort beruflich tätig sind.
Warum ist das Bewusstsein für Frauen im Krisenjournalismus erst in letzter Zeit erwacht?
Die Fotografinnen haben sich in den vergangenen Jahren zunehmend Gehör verschafft und sind öffentlich präsenter, auch in den digitalen Medien. Das hat unter anderem damit zu tun, dass allein die Arbeit für Zeitungen und Agenturen kein ausreichendes Einkommen mehr garantiert. Gleichzeitig gibt es eine Vielzahl von Publikationen, auch Filme oder Ausstellungen wie „Fotografinnen an der Front“ im Kunstpalast in Düsseldorf, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ein größeres Bewusstsein für Geschlechterfragen spielt auch eine Rolle.
Wie sieht das Heldenbild im Krisenjournalismus aus?
Das Bild vom heldenhaften Kriegsfotografen zeichnet sich durch Männlichkeit, Unerschrockenheit, Mut, Abenteurertum und Risikobereitschaft aus. Der Fotograf zieht für eine Aufnahme in den Krieg und ist bereit, dort sein Leben für die „Wahrheit“ zu riskieren. Der Prototyp dieses Heldenbilds ist der 1954 im Indochinakrieg verstorbene Fotograf Robert Capa. Er brillierte durch seine Unerschrockenheit und sein fotografisches Credo: „Wenn deine Bilder nicht gut genug sind, warst du nicht nah genug dran.“ Allerdings wird niemand allein aufgrund seiner Fähigkeiten oder seines Verhaltens zum Helden. Es muss eine Gruppe geben, die diese Eigenschaften als heroisch definiert und die Person als Held verehrt. So wird seit 1955 die Robert-Capa-Medaille an Fotografen und inzwischen auch an Fotografinnen verliehen. Jede Trägerin und jeder Träger bestätigt mit der Medaille den Heldentypus, wie er durch den Namensgeber gezeichnet wurde.

„Die Rolle von stillen Bildern ist nach wie vor nicht zu unterschätzen“, sagt Cornelia Brink. Foto: Klaus Polkowski
Warum ist das Heldentum eine Genderfrage?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Frage nach Heroisierungen aus der Genderperspektive zu stellen. Von Anfang an haben wir im Sonderforschungsbereich nach Heldinnen gesucht. Für die Kriegsfotografie hieße das, die in diesem Feld tätigen Frauen sichtbar zu machen. Da zeigt sich aber schnell, dass Fotografinnen, die als Heldinnen verehrt wurden, die große Ausnahme blieben. Der heldenhafte Kriegsfotograf wurde männlich gedacht, Heldentum und Männlichkeit scheinen sich ganz grundsätzlich wechselseitig aufeinander zu beziehen. Das schließt die Frauen – und auch nicht-heldische Männer – erst einmal aus. Spannend wird es nun, wenn eine lange gültige Vorstellung vom Helden zu bröckeln beginnt. Das ist im Feld der Kriegsfotografie seit einiger Zeit zu beobachten, und es hat Konsequenzen für das Selbstverständnis von Fotografinnen und auch von Fotografen, die sich jeweils zu den alten Heldenbildern verhalten, sich beispielsweise davon abgrenzen oder auch neue heroische Vorbilder entwerfen.
Welche Bedeutung spielt das Geschlecht im Journalismus?
Für den Journalismus ist es sehr aufschlussreich zu fragen, ob und wie die Dinge, die als wichtig im Weltgeschehen gelten und schlussendlich in den Medien landen, von einer Geschlechterperspektive geprägt sind. Dabei stellt sich die Frage, ob es möglicherweise blinde Flecken in der Berichterstattung gibt, wenn der Anteil der Journalistinnen gegenüber ihren männlichen Kollegen geringer ist. Ein Beispiel ist der unterschiedliche Zugang von Frauen und Männern zu bestimmten sozialen Räumen. Journalistinnen konnten im Irak, in Afghanistan oder in Syrien etwa Zutritt zu den privaten Räumen von Frauen bekommen. Männern bleibt dieser Zugang meist verwehrt – damit bleiben diese Einblicke in ihren Fotos unsichtbar. Hier wird deutlich, dass es bei Fragen zur Geschlechterordnung immer um ein relationales Gefüge geht: Über die Zugangsmöglichkeiten der Fotografinnen zum Geschehen kann ich nur dann etwas herausfinden, wenn ich die ihrer männlichen Kollegen mit berücksichtige.

Unerschrocken, abenteuerlustig und ganz nah dran: Robert Capa gilt als Prototyp des Heldenbilds, das dem Beruf des Fotografen anhaftet. Foto: Gerda Taro
Als besonders aussagekräftig gilt das Bild „Republikanische Milizionärin bei der Ausbildung am Strand bei Barcelona“ von Gerda Taro aus dem Jahr 1936. Warum?
Bei der Betrachtung des Fotos von der 1937 im Spanischen Bürgerkrieg verstorbenen Gerda Taro, die mit Robert Capa liiert war, fallen zwei Dinge sofort auf: Die abgebildete Frau trägt eine Pistole und Stöckelschuhe. Diese Gegenstände scheinen nicht zusammenzupassen, da die Pistole für Kampf, Tod und Feindschaft steht und die Stöckelschuhe für Weiblichkeit, Attraktivität und Sich-Zurechtmachen. Das Foto bringt diese Attribute zusammen und verweist damit auf etwas, das über das Bild hinaus gilt: Die gängige Vorstellung von Frauen kollidiert mit ihrer tatsächlichen Rolle im Krieg. Das Foto beinhaltet noch andere männliche und weibliche Zuordnungen, beispielsweise die Hose und die Frisur. In den 1930er Jahren war es nicht selbstverständlich, dass Frauen Hosen trugen. Mit diesem Bild hält Taro nicht nur eine für ihre Zeit ungewöhnliche Praxis fest, sondern schaut gewissermaßen in einen Spiegel. Als eine mit der Kamera bewaffnete Frau dokumentiert sie eine andere Frau, die ebenfalls in einer ungewöhnlichen Situation ist.
Ist die Kriegsfotografie in Zeiten von Bewegtbild und Internet noch von Bedeutung?
Die Rolle von stillen Bildern ist nach wie vor nicht zu unterschätzen. Das zeigt schon die unterschiedliche Aufbewahrung von Fotografien und Filmaufnahmen für das Fernsehen. Eine ausgestrahlte Sendung landet meist im Archiv, während Fotos immer wieder gezeigt werden und damit eine ganz andere Kontinuität haben. Das muss nicht heißen, dass sie immer im gleichen Medium gezeigt werden. Fotos sind nun nicht mehr nur auf Papier gedruckt, sondern finden sich auch auf Plattformen, Blogs und in Online-Enzyklopädien und werden dort in immer neue Zusammenhänge gesetzt. Man könnte sogar fragen: Sind Fotografien in Zeiten des Internets sogar noch wichtiger geworden?