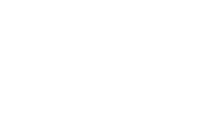Perspektiven auf Migrationspolitik
Freiburg, 23.11.2020
Im Juli 2020 hat Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Ganz oben auf der Agenda steht für das zweite Halbjahr die Verabschiedung eines neuen Asyl-und Migrationspaktes. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte diesen bereits bei ihrem Amtsantritt Ende 2019 an – um Migration in Zukunft „nachhaltig, mit humanem Ansatz“ gestalten zu können. Eine zentrale Voraussetzung für den Erfolg dieses Paktes werden gute und kooperative Beziehungen zu den afrikanischen Staaten sein – und seitens der EU eine Anerkennung der afrikanischen Perspektive auf Migration. Ein Team um Dr. Franzisca Zanker am Arnold-Bergstraesser-Institut der Universität Freiburg hat dazu vor Ort zahlreiche Akteurinnen und Akteure der Migrationspolitik befragt. Dietrich Roeschmann sprach mit der Politikwissenschaftlerin und ihrer Kollegin Leonie Jegen über die Ergebnisse des Forschungsprojektes zur „Politischen Ökonomie der westafrikanischen Migrations-Governance“.
 Hingehen, wo Arbeit ist: Migration gehört in Westafrika zur Normalität und war lange Zeit kein politisch relevantes Thema. Foto: Daniel/stock.adobe.com
Hingehen, wo Arbeit ist: Migration gehört in Westafrika zur Normalität und war lange Zeit kein politisch relevantes Thema. Foto: Daniel/stock.adobe.com
Frau Zanker, das Wort „Migration“ löst bei vielen in Europa die Angst vor einer ernsten Bedrohung aus, nach dem Motto: Millionen afrikanischer Migrantinnen und Migranten warten nur darauf, sich so schnell wie möglich illegal auf den Weg nach Europa zu machen. Ist das eine gute Voraussetzung für einen konstruktiven Dialog?
Franzisca Zanker: Nein, im Gegenteil. Diese europäische Vorstellung von Migration als Problem, das es zu lösen gilt, erschwert jeden aufrichtigen Dialog über mögliche gemeinsame Strategien im Umgang mit Migration. Sie missachtet alle Perspektiven auf das Thema, die außerhalb des europäischen Interesses an Kontrolle, Eindämmung und Rückführung liegen. Doch der Migrationsdruck in Afrika wird in Zukunft steigen, allein schon aufgrund des Bevölkerungswachstums. Die Herausforderungen, die damit verbunden sind, werden wir nur gemeinsam bewältigen können.
Sie haben in Ihrer Studie die unterschiedlichen Perspektiven auf Migration und Migrationspolitik in Afrika untersucht. Wie gingen Sie dabei vor?
Franzisca Zanker: Uns interessierte die Frage, welchen gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Stellenwert Migration in Afrika hat. Dafür haben wir Feldstudien in Nigeria, Gambia, Niger und im Senegal durchgeführt – die ersten beiden Länder sind englischsprachig, die anderen frankophon, entsprechend unterschiedlich sind ihre Kolonialgeschichten. Was ihnen gemeinsam ist: Alle vier Staaten sind wichtige Herkunfts- oder Transitländer auf der Route nach Europa. Doch auch wenn Migration auf dieser Route zunimmt, sollte man nicht vergessen, dass mehr als 80 Prozent der Migrationsbewegungen in Westafrika nach wie vor innerhalb der Region selbst stattfinden.
Und damit weitgehend außerhalb der Wahrnehmung Europas?
Leonie Jegen: Ja. Hinzu kommt: Migration war in Westafrika eigentlich nie ein politisch relevantes Thema, sie ist Normalität. Die Menschen gehen dorthin, wo es Arbeit gibt. In den meisten afrikanischen Ländern gab es deshalb bislang kaum Institutionen oder Programme, die Migration regulierten. Seit die EU ein massives Interesse daran hat, die Migration aus Afrika einzudämmen und bereit ist, dafür viel Geld zu zahlen, hat sich das geändert. Seither ist das Thema stark politisiert, und von externen Geldgebern finanzierte Projekte haben breite Reformprozesse in diesem Bereich angestoßen.
Wie sehen die Perspektiven auf Migration in den einzelnen Staaten aus?
Franzisca Zanker: Das ist sehr unterschiedlich. Beispiel Nigeria: Von dort gibt es seit Jahrzehnten eine sehr hohe Migration nach Europa und in die USA. Oft sind das gut ausgebildete Menschen, die in gut bezahlten Jobs arbeiten und einen Teil ihres Gehalts an ihre Familien nach Nigeria zurücküberweisen. 2019 betrug diese Inflow-Quote etwa sechs Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Nigerias Interesse, diese Einnahmen durch Kooperationen mit der EU zu gefährden, ist entsprechend gering. Mehr noch gilt das für Gambia, wo Rücküberweisungen von im Ausland lebenden Gambiern aktuell 15 Prozent des BIP ausmachen. Während der 22-jährigen Diktatur von Yahya Jammeh froren viele Staaten ihre Entwicklungshilfe ein, wodurch die Rücküberweisungen einen erheblichen Teil des Außeneinkommens in Gambia ausmachten. Heute, drei Jahre nach dem Ende der Diktatur, ist der Anteil der Entwicklungshilfe deutlich gestiegen und beträgt nun 16 Prozent des BIP. Für die Regierung bedeutet das einen schwierigen Balanceakt, denn sie muss immer abwägen zwischen dem Geldsegen aus der EU und den eigenen, auch innenpolitischen Interessen an Migration.
 „Die Kooperation mit Europa kann für Regierende zu erheblichen Legitimitätsproblemen im eigenen Land führen“, sagt Franzisca Zanker, die für ihr Projekt vier afrikanische Staaten untersucht hat. Foto: Ingeborg F. Lehmann
„Die Kooperation mit Europa kann für Regierende zu erheblichen Legitimitätsproblemen im eigenen Land führen“, sagt Franzisca Zanker, die für ihr Projekt vier afrikanische Staaten untersucht hat. Foto: Ingeborg F. Lehmann
Welche Interessen sind das?
Franzisca Zanker: Die Kooperation mit Europa kann für Regierende zu erheblichen Legitimitätsproblemen im eigenen Land führen. Auch hier ist Gambia ein gutes Beispiel. Die EU lockt mit Entwicklungshilfegeldern und fordert im Gegenzug, dass das Land die Voraussetzungen für die Rückkehr abgelehnter Asylbewerberinnen und -bewerber schafft. In Gambia gibt es aber wenige Möglichkeiten für diejenigen, die zurückkehren. Deshalb verweigerte die gambische Regierung Anfang 2019 die Rücknahme aus der EU abgeschobener gambischer Staatsangehöriger. Durch diesen Schritt rückte das kleine Gambia plötzlich in den Fokus internationaler Migrationspolitik. Die Regierung saß zwischen den Stühlen – auf der einen Seite drohte die EU mit der Kürzung von Entwicklungshilfe, auf der anderen Seite positionierten sich große Teile der Bevölkerung, die von der hohen Quote der Rücküberweisungen profitieren. Am Ende wurde das Moratorium nach zehn Monaten aufgehoben.
Leonie Jegen: Ein anders Beispiel ist Niger, das gegenwärtig ärmste Land der Welt. Aus der Migrationsforschung wissen wir, dass die Ärmsten der Armen nicht auf irregulären Wegen nach Europa kommen. Sie haben schlicht nicht das Geld für Schleuser. Dies ist ein Grund dafür, warum nur sehr wenige Menschen den Niger nach Europa verlassen. Offizielle Statistiken zu Rücküberweisungen von nigrischen Migranten sind demnach gering– sie machen gerade mal drei Prozent des BIP aus. Als eines der wichtigsten Transitländer für die Migration nach Europa ist Niger dennoch ein wichtiger Partner für Europa. Die EU nutzte die prekäre Situation des Landes, indem sie der nigrischen Regierung eine Erhöhung der Entwicklungshilfe versprach, wenn sie im Gegenzug im Kampf gegen Schleuser und die irreguläre Migration in Afrika kooperieren würde. Ein erster Schritt war das 2015 verabschiedete Anti-Schleuser-Gesetz.
Seit 2017 ist Niger der Hauptpartner Europas bei der Eindämmung der Migration aus Afrika. Die Externalisierung ihrer Grenzen ließen sich die EU und Deutschland knapp eine Milliarde Euro kosten. Das Geld floss größtenteils in den Sicherheitsapparat, während zugleich deutlich mehr Menschen entlang der Migrationsrouten starben. Wie rechtfertigen Regierende solche Deals?
Leonie Jegen: Tatsächlich stellt sie das immer wieder vor große Legitimitätsprobleme. Hinzu kommen andere Herausforderungen. Im krassen Gegensatz zu der Aufmerksamkeit, die der Bekämpfung der Schleuserkriminalität geschenkt wird, steht etwa die sich verschlechternde Vertreibungssituation im Land, die sich aus Konflikten in der Sahelzone und in Libyen ergeben. Die Folge ist, dass das ärmste Land der Welt eine wachsende Bevölkerung von Vertriebenen unter schwierigen Bedingungen beherbergt.
Warum hat die EU keinen Blick für die afrikanischen Interessen? Würde das nicht vieles einfacher machen?
Franzisca Zanker: Natürlich wissen alle in der EU, dass es unterschiedliche Interessen gibt. Doch mein Eindruck ist, dass nicht richtig zugehört wird. Im Rahmen unseres Forschungsprojekts sprachen wir mit mehr als 130 Personen aus der Politik, aus Institutionen der Regierung, Nichtregierungsorganisationen und der Zivilgesellschaft. Und immer wieder erzählten sie uns, dass Vertreterinnen und Vertreter der europäischen Seite nicht bereit seien, in Migration etwas anderes zu sehen als ein Problem. Dass die Menschen in den meisten afrikanischen Gesellschaften ein anderes, komplexeres Verständnis von Migration haben, komme nicht an.
Viele afrikanische Staaten agieren deshalb zweigleisig, verhandeln mit der EU und schließen zugleich bilaterale Abkommen. Welchen Vorteil rechnen sie sich damit aus?
Franzisca Zanker: Die Zunahme bilateraler Abkommen hat viel mit der unentschiedenen Asyl- und Migrationspolitik der EU zu tun. Es ist schwieriger einen gemeinsamen Nenner unter 28 Staaten zu finden, als gezielt die eigenen Interessen in direkten Verhandlungen mit einem Partnerland zu verfolgen. Frankreich und Spanien stehen so mit dem Senegal im Gespräch, Deutschland mit Gambia. Je mehr Staaten beteiligt sind, desto schwieriger werden die Verhandlungen – mit problematischen Folgen.
Inwiefern?
Franzisca Zanker: Wenn die EU etwa Gelder gibt, um Grenzen in Westafrika zu stärken und so die Fluchtrouten zu kappen, trifft das in ganz erheblichem Maße auch die regionale Migration und das Recht auf Freizügigkeit, welche die Afrikanische Union erst 2018 erneut bekräftigt hat. Damit stehen afrikanische Regierungen vor einer schwierigen Situation. Dabei müssten sich alle Beteiligten gemeinsam fragen: Welche Grenzen wollen wir? Wie müssten diese beschaffen sein, damit es gelingen kann, Terror und Schleuserkriminalität nachhaltig zu bekämpfen, ohne die täglichen Migrationswege zu stören?
Das Fazit Ihrer Studie ist eindeutig: Sichere Migrationswege seien die Voraussetzung, um irreguläre Migration in den Griff zu bekommen.
Franzisca Zanker: Das wird leider viel zu oft gegeneinander ausgespielt. Auf der europäischen Seite gibt es die Forderung der Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern. Auf der afrikanischen Seite dagegen ein großes Interesse an legalen Möglichkeiten der Migration nach Europa. Die EU sagt: Die Regierenden in Afrika sollen erst einmal besser kooperieren, dann geben wir ihnen legale Migrationswege. Das führt absehbar zu Konflikten, denn diese Diskussion wird nicht auf Augenhöhe geführt. Die afrikanischen Partner fühlen sich nicht wahrgenommen. Doch ohne sie wird die EU nicht agieren können.