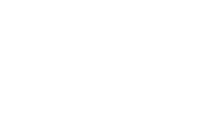Bunter ist besser
Freiburg, 24.08.2018
Stelle sie einem Kollegen bei einer Fachkonferenz eine Frage zu seiner Arbeit, bekomme sie häufiger erst einmal eine allgemeine Einführung und nicht die Antwort. Die Biomaterialforscherin Dr. Maria Asplund weiß nicht nur aus eigener Erfahrung, dass die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen den gesamten Wissenschaftsbetrieb durchzieht – und dadurch das Potenzial von Forscherinnen und Forschern begrenzt. Dabei mache Vielfalt jedes Team stärker. In einem jüngst veröffentlichten Artikel zeigt Asplund Wege zum Umdenken auf.
 Foto: Robert Kneschke/Fotolia
Foto: Robert Kneschke/Fotolia
Nein, der Mensch ist nicht so rational, wie er immer tut. Bittet man zum Beispiel fünfjährige Kinder darum, einen Wissenschaftler zu zeichnen, dann bringt die eine Hälfte Forscherinnen, die andere Hälfte Forscher aufs Papier. Nach nur fünf Jahren nimmt die Wahrscheinlichkeit, sich bei dem Wort „Wissenschaftler“ eine Frau zu denken, allerdings rapide ab: Gerade mal ein Viertel der Zehnjährigen, fast nur Mädchen, malen eine Wissenschaftlerin. Im Teenageralter sind es noch weniger, wie ein Team der US-amerikanischen Northwestern University neulich in einer Studie gezeigt hat.
Eine, die auf dieses Missverhältnis aufmerksam machen will, ist Dr. Maria Asplund. Nebenbei, denn eigentlich entwickelt die Freiburger Elektrotechnikerin und Biomaterialforscherin am Freiburger Institut für Mikrosystemtechnik und zusammen mit ihrer Arbeitsgruppe am Exzellenzcluster BrainLinks-BrainTools ein besonderes Polymer, das später einmal in der Medizin zum Einsatz kommen und die Wundheilung beschleunigen soll. Dafür hat Asplund eine begehrte Auszeichnung eingeheimst: den ERC Starting Grant des Europäischen Forschungsrats.
Ein altes Thema, aber nicht abgehakt
Asplund hat jüngst mit ihrer Kollegin Cristin Welle, Assistenzprofessorin für Neurochirurgie und Bioengineering an der Universität in Colorado/USA, viel Zeit in einen Artikel investiert, in dem es nicht um ihre Forschung ging – sondern um die Ungleichbehandlung von Frauen und Männern in den so genannten STEM-Disziplinen der Wissenschaft. STEM steht für: Science, Technology, Engineering und Mathematics. „Wir haben alle bias“, sagt sie. „Bias“ ist das, was täglich in den Köpfen aller Menschen passiert. Und das vollkommen unbewusst. Der Begriff kommt aus dem Englischen und bedeutet so etwas wie „Voreingenommenheit“.
Asplund konkretisiert: „Wir haben verinnerlicht, wie etwas zu sein hat, zum Beispiel, dass ein Forscher männlich ist. Diese impliziten Annahmen sitzen so tief, dass sie sogar die scheinbar neutralen Bewertungssysteme innerhalb der Wissenschaft korrumpieren können, wie Noten oder Punktesysteme.“ Heiße ein Bewerber „John“, führt Asplund mit Verweis auf eine Untersuchung der Yale University/USA aus, die in der renommierten Fachzeitschrift „Proceedings of the National Academy of Sciences“ erschienen ist, sei die Wahrscheinlichkeit größer, dass er und nicht „Jennifer“ die Stelle bekomme. Auch wenn Jennifer objektiv betrachtet die gleichen Qualifikationen wie John mitbringe. Das Thema ist alt, aber längst nicht bearbeitet, wie die von Asplund und Welle zusammengefassten aktuellen Studienergebnisse beweisen.
Neueste Studienergebnisse auf einen Blick
Die Forscherin hat auch selbst immer wieder erlebt, dass Frau in der Wissenschaft nicht gleich Mann ist: Stelle sie auf einer Konferenz einem Kollegen eine Frage zu seiner Arbeit, bekomme sie häufig erst einmal eine allgemeine Einführung – und keine Antwort. Gerade so, als wisse sie nicht, worum es gehe. Das Thema treibt Asplund schon länger um. Sie hat immer wieder viel dazu gelesen.
 In ihrer Heimat Schweden sei man deutlich weiter, sagt Maria Asplund: „Die Ungleichbehandlung in der Wissenschaft wird dort viel öfters thematisiert, vor allem aber reflektiert.“ Foto: Klaus Polkowski
In ihrer Heimat Schweden sei man deutlich weiter, sagt Maria Asplund: „Die Ungleichbehandlung in der Wissenschaft wird dort viel öfters thematisiert, vor allem aber reflektiert.“ Foto: Klaus Polkowski
In ihrem Heimatland Schweden sei man damit deutlich weiter. „Die Ungleichbehandlung in der Wissenschaft wird dort viel öfters thematisiert, vor allem aber reflektiert.“ Nach einem Vortrag des Chemieprofessors Paul Walton in Freiburg über die Gleichstellungsarbeit in der Wissenschaft beschloss sie, selbst aktiv zu werden und zusammen mit Welle die neuesten Studienergebnisse zusammenzutragen, Lösungsstrategien zu entwickeln und alles öffentlich zu machen. Der Fachartikel ist im August 2018 im Journal „Neuron“ erschienen.
Durchmischte Teams sind stärker
Die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen ziehe sich durch den gesamten Wissenschaftsbetrieb, sagt Asplund: „Das Vertrackte an der Sache ist, dass alle mittun. Nicht mit Absicht, aber zuverlässig." Bias lässt sich also nicht auf das althergebrachte Klischee der unterdrückten Frau reduzieren, denn beide Geschlechter verzerren durch ihre über Jahre antrainierte Sichtweise die Wirklichkeit. Individuelle Vorurteile kollektivieren sich – auch in der Wissenschaft, denn der Mensch bleibt gerne unter Seinesgleichen. Die Folge dieser kollektiven Bias ist, dass sich die Forschung in den Laboren und Arbeitsgruppen selbst limitiert. Sie bringe sich um viel Know-how, sagt Asplund. Ein durchmischtes Forschungsteam leiste mehr als ein homogenes.
Mit einer Gleichstellungsbeauftragten alleine lässt sich der Mensch nicht umprogrammieren, dessen ist sich die 39-jährige Wissenschaftlerin sicher. Es bedarf mehr. Asplund und Welle haben fünf Handlungsempfehlungen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aufgesetzt. Wichtig sei, erst einmal anzuerkennen, wie Bias wirken, um dann im nächsten Schritt Vielfalt zuzulassen, zum Beispiel bei der Zusammenstellung wissenschaftlicher Teams. Jede und jeder muss sich verantwortlich fühlen. Individuen genauso wie Gruppen oder universitäre Gremien und Institutionen. Um die Wissenschaft zu verbessern, braucht es ein Umdenken. Dringend.
Stephanie Streif