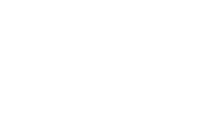„Damit haben wir nur gewonnen“
Freiburg, 20.08.2020
Ein Thriller über die ethischen Grenzen der Forschung am Menschen, zum Großteil angesiedelt an der Universität Freiburg: Der Entertainment-Dienst Netflix hat am 20. August 2020 die erste Staffel der Serie „Biohackers“ veröffentlicht. Der Ethiker Privatdozent Dr. Joachim Boldt, der Mediziner Prof. Dr. Toni Cathomen und die Synthetische Biologin Prof. Dr. Barbara Di Ventura haben sich die sechs Folgen vorab angesehen. Mathilde Bessert-Nettelbeck und Nicolas Scherger haben sie nach ihren Eindrücken gefragt.
 Die Heldin: Mia, Medizinstudentin im ersten Semester (rechts), vor der Freiburger Universitätsbibliothek. Quelle: Netflix
Die Heldin: Mia, Medizinstudentin im ersten Semester (rechts), vor der Freiburger Universitätsbibliothek. Quelle: Netflix
Herr Boldt, Frau Di Ventura, Herr Cathomen: Haben Sie Freiburg und Ihre Universität in der Serie wiedererkannt?
Joachim Boldt: Die Universität Freiburg von innen sieht eigentlich anders aus, aber die Kulisse stimmt: Die Gegensätze zwischen schöner Natur und Hightech-Labors – das sieht toll aus.
Barbara Di Ventura: Ja, die Universität war gut wiederzuerkennen, und besonders die Universitätsbibliothek finde ich fantastisch. Aber das „Lorenz Exzellenz Zentrum“, die Firma der Protagonistin, befindet sich offenbar nicht in Freiburg.
Toni Cathomen: Die Bilder sind sehr überzeugend: von der Stadt, dem Schwarzwald mit dem Zug, der durch die Berge fährt, und von der Universität – ich habe die Biologie erkannt und auch die UB.
--- VORSICHT, SPOILER! ---
 Die Serie „Biohackers“ zeigt 95 Prozent Fiction und fünf Prozent Science, sagt Toni Cathomen, Direktor des Instituts für Transfusionsmedizin und Gentherapie am Universitätsklinikum Freiburg. Foto: Universitätsklinikum Freiburg
Die Serie „Biohackers“ zeigt 95 Prozent Fiction und fünf Prozent Science, sagt Toni Cathomen, Direktor des Instituts für Transfusionsmedizin und Gentherapie am Universitätsklinikum Freiburg. Foto: Universitätsklinikum Freiburg
Eine Wissenschaftlerin führt in der Serie neben ihrer Tätigkeit an der Universität in ihren Firmenlabors unbeobachtet Versuche an menschlichen Embryos, genmodifizierten Moskitos und Viren durch. Wie realistisch ist das Bild von der Wissenschaft, das hier gezeichnet wird?
Cathomen: 95 Prozent Fiction und fünf Prozent Science, würde ich behaupten. Es ist zum Beispiel möglich, transgene Mäuse herzustellen, die ein Gen für das grün fluoreszierende Protein in der Haut tragen. Die müssen Sie aber mit ultraviolettem Licht anstrahlen, damit sie leuchten. Aber das Meiste, was gezeigt wird, ist heutzutage nicht möglich. Auch die Arbeitsgeschwindigkeit ist unrealistisch. Ich wäre froh, wenn im Labor alle Verfahren so schnell ablaufen würden wie in der Serie, aber mit dem wissenschaftlichen Alltag hat das nichts zu tun. Und es ist illusorisch, dass ein und derselbe Forscher Pflanzen, Menschen und Insekten genetisch modifizieren kann. Wir sind hochspezialisiert in dem, was wir tun.
Di Ventura: Ja, diese Figuren können wirklich alles. Die Hauptfigur Mia, Medizinstudentin im ersten Semester, stellt am ersten Tag ihres Praktikums ein rotes statt eines grünen Fluoreszenzproteins her – das ist komplett unwahrscheinlich. Die Genschere CRISPR/Cas, die immer wieder vorkommt, wäre für viele der beschriebenen Modifikationen gar nicht notwendig. Und viele Anwendungen sind einfach nicht möglich und werden es wahrscheinlich auch niemals sein. Man kann zum Beispiel nicht alle Zellen eines erwachsenen Menschen gezielt genetisch verändern, wie die Figur Jasper es in der Serie behauptet. Und genetisch modifizierte Pflanzen hat man bestimmt nicht zu Hause auf dem Schreibtisch stehen – die müssen im Labor bleiben. Aber insgesamt: toll gemacht. Ich fand die Serie sehr interessant.
Boldt: Der Plot erinnert mich an den Fall des chinesischen Wissenschaftlers He Jiankui: Im November 2018 behauptete er, mit Hilfe der Gene-Editing-Technologie die ersten menschlichen Embryos genetisch verändert zu haben. Ob das stimmt, ist nach wie vor unklar. In der Serie taucht eine Wissenschaftlerin auf, die auf eigene Faust loslegt, ein eigenes Labor hat und von der Universität losgekoppelt eigene Experimente macht – da gibt es schon Parallelen. Dass aber so etwas in Deutschland passiert und die einzelnen Schritte so schnell gehen, ist natürlich Fiktion. Außerdem sind die Figuren recht holzschnittartig: Die Forscherin, die um jeden Preis ihrem Ehrgeiz nacheifert und die Studentin, die für das Gute kämpft – da hätte ich mir mehr Komplexität erhofft. Aber die Geschichte ist spannend, und man sollte sie nicht nach dem Motto bewerten: Oh je, und morgen passiert das bei uns.
Die Forscherin Lorenz ist aufgemacht wie der klassische verrückte Professor und Bösewicht der Filmgeschichte: Sind Sie tatsächlich schon einmal Menschen begegnet, die derart stereotype Vorstellungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern haben?
Cathomen: Mir ist das zu meiner Person noch nicht begegnet. Dass wir hier keine illegalen Experimente an Menschen machen, ist ja klar. Aber für das Stereotyp des „Mad Scientist“ gibt es schon prominente Beispiele, auf die sich auch Einiges in der Serie bezieht. Solche Figuren sind mir bekannt als brillante, aber etwas eigensinnige Wissenschaftler, wie etwa der Biologe George Church, der in den USA an kontroversen Projekten arbeitet, um Mammuts wiederzubeleben oder um Menschen Organe aus Hausschweinen zu transplantieren. Was sie antreibt, ist aber eine Vision von dem, was der Mensch erreichen kann – und nicht, wie in der Serie, Macht und Geld.
Boldt: Diese Person schien mir auch eine Inspiration zu sein. In seinem Buch „Regenesis“ skizziert Church eine Idee zur Verbesserung des Immunsystems, sodass ein Mensch überhaupt nicht mehr von Krankheitserregern befallen werden kann. Diese Idee steckt ja auch in dem Plot der „Biohackers“, aber sie ist erstmal eine Vision, die sich in der wirklichen Welt nicht unbedingt umsetzen lässt. Es gibt in der Serie also schon immer irgendwo Anknüpfungspunkte an die Realität, aber dann wird natürlich alles ins Übertriebene gesteigert. Schließlich muss eine spannende Geschichte erzählt werden.
Di Ventura: Der Charakter der Forscherin Lorenz ist sehr amerikanisch: Keine Professorin an der Universität Freiburg würde so mit ihren Studierenden umgehen. Aber was sie über Synthetische Biologie sagt, finde ich schon überzeugend – dass diese Technologie dem Menschen erlaubt, selbst zu erschaffen: Wir sind in der Biologie von einer Phase, in der wir herausfinden wollten, was die Natur macht, zu einer Phase übergegangen, in der wir bestimmen können, was wir mit der Natur machen. Somit sind die Aussagen etwas übertrieben, aber nicht falsch.
 Die Gegenspielerin: Professorin Tanja Lorenz hält eine Vorlesung über Synthetische Biologie. Quelle: Netflix
Die Gegenspielerin: Professorin Tanja Lorenz hält eine Vorlesung über Synthetische Biologie. Quelle: Netflix
In der Serie wird dargestellt, dass die Forschungsarbeiten der Protagonistin außerhalb der Universität stattfinden, da sie illegal sind. Auch die Ethikkommission der Universität und des Klinikums wird mehrmals erwähnt. Was wäre für diese Instanz die rote Linie?
Boldt: Die Ethikkommission würde nie genehmigen, dass an gesunden Embryonen genetische Veränderungen vorgenommen werden, die zu Erkrankungen führen. Generell ist ein Eingriff an menschlichen Embryonen in der so genannten Keimbahntherapie – wie es auch in der Serie richtig dargestellt wird – in Deutschland illegal. Dafür sind die Konsequenzen für den Organismus noch nicht klar genug. Im Allgemeinen ist es die Aufgabe der Ethikkommission, Anträge für klinische Studien zu prüfen, die an der Universität stattfinden. Aber mit verdeckten Ermittlerinnen und Ermittlern, wie in der Serie angedeutet, arbeitet sie selbstverständlich nicht.
Jasper arbeitet als junger Wissenschaftler an einem Thema, das ihn aufgrund einer Krankheit persönlich betrifft. Ist das aus ethischer Sicht angemessen?
Boldt: Das ist eine der besten Quellen für Engagement und für das Verständnis einer Erkrankung. Daher finde ich das unproblematisch. Meistens geht es solchen Menschen eher darum, in Zukunft Erkrankten zu helfen, weil sie wissen, wie es sich anfühlt, mit einer solchen Krankheit – hier zum Beispiel Chorea Huntington – zu leben. Und das ist sehr positiv. Aber die Figur in der Serie steht ja in einem Abhängigkeitsverhältnis und wird ausgenutzt. Das wiederum ist hochproblematisch.
Die Genfähre ist eine weitere Technologie, die in der Serie eine prominente Rolle spielt. Worum handelt es sich dabei?
Cathomen: Es bleibt relativ vage, was für Genfähren gemeint sind, aber ich gehe davon aus, dass die Autorinnen und Autoren so genannte Virus-Vektoren im Kopf haben. Das sind klinisch zugelassene Genfähren, die es ermöglichen, bestimmte Gendefekte gezielt zu behandeln und die bei Patientinnen und Patienten auch schon eingesetzt werden. Wir können zum Beispiel Menschen helfen, denen ein Gerinnungsfaktor im Blut fehlt: Das benötigte Gen wird in die Leberzellen eingeführt, und der Faktor wird dann dort produziert und ins Blut freigesetzt.
Es wird in der Serie behauptet, Forschung in der Synthetischen Biologie wäre zu schnell für Lehrbücher und China und die USA hätten in der klinischen Übertragung der Technologien die Nase vorn. Stimmt das?
Cathomen: Da steckt sehr viel Wahrheit drin. Deutschland und Europa hinken hinterher. Und dass ein Lehrbuch in einem Feld, das sich so rasch entwickelt, schnell an Aktualität verliert, ist auch richtig. Es gibt zum Beispiel kaum Lehrbücher zum Thema CRISPR/Cas. Da würde ich mir auch nicht die Mühe machen, eines zu schreiben, da es so schnell überholt wäre.
Was möchten Sie Studieninteressierten oder Studierenden, die diese Serie anschauen, mit auf den Weg geben?
Di Ventura: Arbeitet genauso hart wie die Assistentin von Frau Lorenz! (lacht) Nein, aber einfach: Vorsicht, es ist nicht so leicht, wie es aussieht. Es ist unrealistisch, wie schnell die Studierenden in der Lage sind, zum Beispiel genetische Konstrukte zu synthetisieren oder CRISPR-Cas anzuwenden. Das alles ist zwar spannend, aber es ist harte Arbeit und dauert ein bisschen länger, bis man so weit ist.
In der Serie gibt es eine regelrechte Biohacker-Community. Ist das realistisch?
Boldt: Im Umfeld des Wettbewerbs iGEM – kurz für „International Genetically Engineered Machine Competition“ – gibt es beispielsweise durchaus Studierende, die im Labor in der Universität zum großen Teil unter eigener Verantwortung sehr viel ausprobieren. Das ist natürlich ganz anders als in der Serie mit dem Labor in der Hütte, aber man weiß schon, wovon das inspiriert ist.
Di Ventura: Und gerade in den USA gibt es Garagenlabors, und die Idee, dass sich Menschen treffen und etwas zusammen ausprobieren, ist dort schon verbreitet. Ebenso gibt es Firmen, die Gensynthesen machen und bei denen man beispielsweise DNA-Abschnitte für Toxine mit gesundheitsschädlicher Wirkung bestellen kann.
 Die Serie knüpft an der Realität an, steigert die Darstellungen dann aber aus Gründen der Dramaturgie ins Übertriebene, bilanziert Joachim Boldt, stellvertretender Direktor des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin. Foto: Conny Ehm
Die Serie knüpft an der Realität an, steigert die Darstellungen dann aber aus Gründen der Dramaturgie ins Übertriebene, bilanziert Joachim Boldt, stellvertretender Direktor des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin. Foto: Conny Ehm
Aber ist das nicht reguliert?
Boldt: Solche Community Labs sind in den USA legal. Und dafür, was Firmen, die Genabschnitte herstellen, bei einer Bestellung überprüfen müssen, gibt es auch in Europa keine Regularien. Das ist aus meiner Perspektive ein offenes Feld. Vor ein paar Jahren haben Journalistinnen und Journalisten das ausgetestet, an ihre Privatadressen liefern lassen – und das gewünschte Material bekommen. Das ist nicht so, wie man sich das wünschen würde.
Di Ventura: Das überrascht mich, denn wir brauchen im Labor immer eine Identifikationsnummer, um etwas bestellen zu können. Das dauert dann ein paar Tage – mit der Begründung, dass erst überprüft werden müsse, ob wir tatsächlich eine wissenschaftliche Einrichtung sind. Es wäre jedenfalls beunruhigend, wenn diese Firmen einfach von irgendjemandem etwas potenziell Gefährliches synthetisieren lassen könnten.
Cathomen: Ein Schreckensszenario wäre tatsächlich, dass man die Gensynthese nutzt, um extrem pathogene Viren herzustellen. Das klingt ja auch in der Serie mit den Moskitos an. Früher musste man erst an ein Virus rankommen, um im Labor mit ihm zu arbeiten. Heute kann ich die Sequenz für das Virus bestellen, wenn ich sie kenne, und es dann im Labor herstellen. Das würden auch schon Biologie-Masterstudierende unserer Universität schaffen.
Ein anderes Thema ist, was man aus der DNA herauslesen kann – von der Gesichtsrekonstruktion bis zum Todesdatum. Was halten Sie von dem Bild, das die Serie diesbezüglich zeichnet?
Boldt: Wie bei vielen anderen Themen würde ich auch hier darauf hoffen, dass die Leute unterscheiden: zwischen Fiktion und Dramaturgie auf der einen, den realen Möglichkeiten auf der anderen Seite. Wenn man das nicht kann, wird einen diese Serie in die Irre führen. Sie spricht viele ethische Fragen an: Muss man aus der eigenen DNA alles wissen, was man über das eigene Leben wissen kann? Darüber gab es auch in Deutschland große Diskussionen, ebenso wie über Datensicherheit: Da hat Frau Lorenz auf einmal alle diese sensiblen Daten zu Hause gespeichert, was ja völlig verrückt ist. Mit solchen Darstellungen habe ich etwas Bauchgrimmen. Denn es ist natürlich gut, dass wichtige Themen erwähnt werden – aber sie werden immer nur angetippt, und schon kommt ein Schnitt, die nächste Szene, ein anderes Thema. Dass solche spannenden Diskussionen nicht als längerer Strang weiterverfolgt werden, finde ich ein bisschen schade.
Di Ventura: Aber die Momente für die ethischen Fragen sind ja da. Zum Beispiel sagt eine der Probandinnen, dass sie eben nicht wissen möchte, woran sie sterben wird – und daran sehen die Zuschauerinnen und Zuschauer: Okay, es gibt Menschen, die lehnen das ab. Das reicht aus meiner Sicht aus, um die Frage aufzuwerfen, wie man selbst dazu steht.
Cathomen: Wenn man die ethischen Themen wirklich ausdiskutieren möchte, ist das vielleicht eher etwas für eine Talkshow. Die Serie hat ja eine enorme Geschwindigkeit, um den Spannungsbogen hoch zu halten.
 Die Handlung kann Neugier auf Themen wie Synthetische Biologie oder Gentherapie wecken, findet Barbara Di Ventura, Professorin für Biologische Signalforschung an der Fakultät für Biologie. Foto: Jürgen Gocke
Die Handlung kann Neugier auf Themen wie Synthetische Biologie oder Gentherapie wecken, findet Barbara Di Ventura, Professorin für Biologische Signalforschung an der Fakultät für Biologie. Foto: Jürgen Gocke
Würden Sie sagen, ein solches Format ist hilfreich, weil es vielleicht auch ein ansonsten eher wissenschaftsfernes Publikum ansprechen und Denkanstöße geben kann?
Di Ventura: Es war das erste Mal, dass ich eine Definition von Synthetischer Biologie in einer Fernsehserie gesehen habe. Das ist fantastisch. Auch wenn die meisten wissenschaftlichen Inhalte, die gezeigt werden, unrealistisch sind: Ich finde, dass die Serie Neugier wecken kann. Vielleicht möchten die Menschen ein bisschen mehr über Synthetische Biologie oder über Gentherapie wissen, nachdem sie die Folgen gesehen haben. Dann haben wir die Möglichkeit zu erklären, was realistisch ist und was vielleicht erst in Zukunft möglich sein wird. Und auch, dass die Serie in Freiburg spielt, ist originell. Wir werden als eine der besten deutschen Universitäten vorgestellt – das ist für uns ein unglaublich schönes Kompliment.
Cathomen: Es gibt ja viele Fernsehserien, die in einem medizinischen Umfeld spielen. Aber es ist klar, dass sie Fiktion sind. Dass jemand, der eine Arztserie guckt, sich daraufhin überlegt, vielleicht Medizin zu studieren, glaube ich eher nicht. Aber ich finde auch, dass „Biohackers“ das Publikum dazu anregen kann, über unsere Disziplinen nachzudenken und sich darüber zu informieren – und die Universität Freiburg kommt darin sehr gut weg. Damit haben wir nur gewonnen.