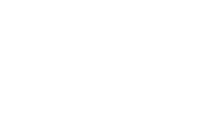Streitbare Stimmen
Freiburg, 24.04.2017
Ausgiebig gelobt und kritisiert, herbeigesehnt und gefürchtet: Der Exzellenzwettbewerb ist seit knapp zehn Jahren das vielleicht umstrittenste Thema der deutschen Hochschulpolitik. Seit Bund und Länder angekündigt haben, dass der Wettbewerb ab der bevorstehenden dritten Runde zu einer dauerhaften Säule in der Hochschullandschaft werden soll, sind die Stimmen der Kritiker und Befürworter energischer geworden. Die Albert-Ludwigs-Universität will dem Austausch eine Plattform bieten: Am 28. April 2017 findet in Freiburg ab 18 Uhr die erste öffentliche Diskussionsrunde satt, bei der Forschende, Studierende sowie Akteurinnen und Akteure aus der Wissenschaftspolitik Pro- und Kontra-Argumente präsentieren werden.
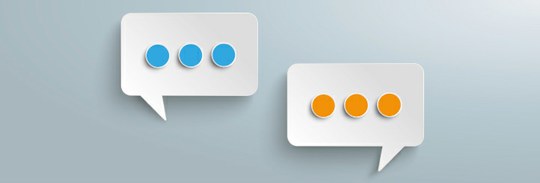
Grafik: Style-Photography/Fotolia
Eine Einstimmung auf den kritischen Abend liefert das Interview mit den drei Freiburger Universitätsratsmitgliedern Dr. Beate Konze-Thomas, Dr. Marion Mangelsdorf und Anna-Lena Osterholt. Anlass für das Gespräch ist eine von Mangelsdorf und Osterholt veröffentlichte Stellungnahme, in der sie davor warnen, dass der Wettbewerb soziale Ungleichheit und Ungerechtigkeit bewirken und eine Elitebildung schaffen könnte. Konze-Thomas, die als ehemalige Leiterin der Abteilung „Programm und Infrastrukturförderung“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft den Wettbewerb mitentwickelt hat, weist die Kritik zurück – und wird auch am 28. April ihren Standpunkt verteidigen. Rimma Gerenstein hat die drei zum Gespräch eingeladen.
Frau Konze-Thomas, Sie haben die Exzellenzinitiative mitentwickelt. War es Ihr Ziel, Eliten zu schaffen und die Hochschullandschaft in Deutschland hierarchischer zu gestalten?
Beate Konze-Thomas: Der Bund und die Länder wollten ein Programm entwickeln, das die deutschen Universitäten im internationalen Vergleich attraktiver macht und die Forschung stärkt. Mitte der 2000er Jahre, als die Exzellenzinitiative nach und nach Gestalt annahm, wurde gerne behauptet, dass die circa 100 Universitäten des Landes eigentlich gleich gut seien, aber das stimmte nicht. Es herrschten schon immer Qualitätsunterschiede. Das Ziel der Exzellenzinitiative war es durchaus, das deutsche Hochschulsystem zu differenzieren und die Stärken herauszustellen. Von „Elite“ war nie die Rede.
Stimmt. „Elite“ war ein Begriff, den vor allem die Medien der Initiative aufdrückten. Trotzdem kann man nicht von der Hand weisen, dass der Exzellenzwettbewerb einige wenige Universitäten intensiv fördert und dadurch bevorteilt.
Anna-Lena Osterholt: Genau an diesem Punkt sehen wir ein Problem, auf das wir mit unserer Stellungnahme aufmerksam machen möchten: Wenn eine Universität dauerhaft auf ein Podest gehoben wird, könnten dadurch soziale Nachteile entstehen. Das ist gerade in der aktuellen Runde zu befürchten, die ja vorsieht, die Exzellenz dauerhaft einzurichten.
Konze-Thomas: Das muss man relativieren. Die Universitäten erhalten ihre Grundfinanzierung von den Ländern. Freiburg zum Beispiel hat ein Budget von ungefähr 300 Millionen Euro im Jahr. Der Exzellenzwettbewerb hingegen würde einer Universität etwa zwölf Millionen Euro jährlich einbringen. Das sind ungefähr vier Prozent des Gesamthaushalts. Sagen Sie mir bitte, wie das für soziale Ungerechtigkeit sorgen soll?

Beate Konze-Thomas ist externes Mitglied im Universitätsrat. Bis Ende 2014 leitete sie die Abteilung „Programm- und Infrastrukturförderung“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Foto: Privat
Osterholt: Ich erinnere mich an die Verhandlungen zum Hochschulfinanzierungspakt vor zwei Jahren in Baden-Württemberg. Damals wurde eindeutig, dass alle Landesuniversitäten zu wenig Geld haben, um ihren eigenen Ansprüchen in Forschung und Lehre gerecht zu werden. Da frage ich mich schon, ob zwölf Millionen Euro wirklich so wenig sind, wie Sie sagen.
Konze-Thomas: Gut, dann lassen Sie uns das mal durchrechnen. Angenommen, wir verteilen die 533 Millionen Euro, die Bund und Länder jährlich bereitstellen, nach dem Gießkannenprinzip: Jede Universität bekommt gleich viel, also ungefähr fünf Millionen. Glauben Sie mir, mit solchen Beträgen lässt sich auf lange Sicht gar nichts bewirken.
Osterholt: Aber die Universitäten könnten das Geld einsetzen, um unterschiedliche Freiräume zu fördern. Auch wenn das nur minimale Freiräume wären – sie könnten wertvolle Potenziale freisetzen.
Marion Mangelsdorf: Ich möchte bei dem Begriff „Exzellenz“ ansetzen. Ich glaube schon, dass dadurch eine gewisse Elitebildung und Ungleichheit entsteht. Da geht es nicht nur um die Verteilung von Geldern, sondern um die Frage, was in die Gesellschaft im Namen der so genannten Exzellenz transportiert wird. Sicherlich brauchen wir Vordenkerinnen und Vordenker, aber wir befinden uns in einer Zeit, in der wir uns fragen müssen, wen wir fördern, und wen wir wie an die Spitze bringen. Es kann nicht sein, dass nur Universitäten mit Alleinstellungsmerkmalen nach oben kommen und dauerhaft dort bleiben.
Konze-Thomas: Das ist richtig, aber das ist auch nicht ganz unvernünftig. Wir leben in einem reichen Land, aber wir können uns trotzdem keine 100 Exzellenzuniversitäten leisten: Wir müssen uns also genau überlegen, nach welchen Kriterien wir das Geld, das die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zur Verfügung stellen, so verteilen, dass es unserer Gesellschaft langfristig am besten nutzt – dazu gehört auch der wirtschaftliche Aspekt, und dabei spielt es nun mal eine Rolle, wie die deutschen Universitäten im internationalen Vergleich abschneiden.
Osterholt: Meine Sorge ist es, dass die Universitäten auf Dauer ihre Kriterien so verschärfen, dass nur noch eine bestimmte Gruppe von Studierenden eine Zulassung erhält, also zum Beispiel nur Leute mit einem 1,0-Abitur. Das wäre dann zwar schön, wenn das gesamte Niveau angehoben wäre, aber das wäre dann auch eine sehr homogene Gruppe. Studienanwärterinnen und Studienanwärter, die aus bildungsfernen Familien kommen, hätten womöglich nicht die gleichen Chancen.
Konze-Thomas: Es kann natürlich sein, dass die Universitäten bei der Zulassung wählerischer werden. Aber das hat nichts mit Benachteiligung zu tun, sondern schlicht mit Leistung.
Mangelsdorf: Für mich hört sich der Exzellenzwettbewerb stark nach dem US-amerikanischen Hochschulsystem an: Nur reiche Familien können es sich leisten, ihre Kinder auf die noblen Universitäten zu schicken, die enorm viel Geld kosten. Alle anderen werden später im Berufsleben abgehängt und werden zu sozialen Verlierern, weil sie nicht an der „richtigen“ Universität studiert haben.

Marion Mangelsdorf vertritt im Universitätsrat als beratendes Mitglied die Gruppe des wissenschaftlichen Dienstes. Sie koordiniert den Studiengang „Gender Studies“ an der Universität Freiburg. Foto: Patrick Seeger
Konze-Thomas: Das stimmt doch nicht. 55 Prozent der Studierenden in Harvard bekommen ein Stipendium und sind somit ganz oder teilweise von den Studiengebühren befreit. Aber darum geht es hier ja nicht. Nehmen wir zum Beispiel die Universität Passau oder die Universität Siegen. Beide haben keinen Exzellenztitel und auch keine Cluster. Dass dort nun wahrscheinlich nicht die größten Entdeckungen der Welt zustande kommen werden, wissen sie selber. Trotzdem sind sie solide Universitäten, an denen die Studierenden eine ausgezeichnete Ausbildung erhalten und später gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben.
Frau Mangelsdorf, Frau Osterholt, Sie warnen in Ihrer Stellungnahme davor, dass Frauen im Exzellenzwettbewerb abgehängt werden könnten. Was meinen Sie damit?
Mangelsdorf: Wir kennen ja alle die Zahlen: Bei den Studierenden ist der Frauenanteil noch hoch, bei Promovierenden wird er schon geringer, aber wenn wir einen Blick auf die Professuren werfen, wird es bedrohlich ungleich. Da die Exzellenzstrategie zum Beispiel verstärkt naturwissenschaftliche Cluster fördert, die meistens von Professoren geleitet werden, verschärft sich die Ungerechtigkeit. Das Gleichstellungskonzept der Deutschen Forschungsgemeinschaft schätze ich sehr; es hat auch einiges in den Sonderforschungsbereichen (SFB) und Graduiertenkollegs bewirkt. Aber wir sind noch weit davon entfernt, dass Frauen genauso sichtbar in der Forschung sind wie Männer. Wir dürfen nicht vergessen: Je mehr Leistung jemand bringt und je mehr jemand gefördert wird, desto mehr gesellschaftliche Verantwortung muss er auch übernehmen.
Konze-Thomas: Da stimme ich Ihnen zu. Aber vor der Verantwortung scheute die Exzellenzinitiative nicht zurück: Sie sagen ja selbst, dass es unter anderem auch den Gleichstellungsstandards des Wettbewerbs zu verdanken ist, dass zum Beispiel mehr Frauen auf Leitungsebenen vertreten sind oder dass der wissenschaftliche Nachwuchs für Gender und Diversity sensibilisiert wird. All das gab es vor der Exzellenzinitiative eigentlich kaum – aber dadurch, dass sich die deutschen Universitäten auch auf einer internationalen Bühne behaupten mussten, haben sie diese Standards etabliert und bauen sie weiter aus.
Wie steht es denn um die Gleichheit auf der Fachebene? Betrachtet man die bisher geförderten Exzellenzcluster, überwiegen deutlich die Verbünde aus den Technik- und Naturwissenschaften.
Konze-Thomas: Das hat einen guten Grund. Bei den Exzellenzclustern steht die fächerübergreifende Kooperation im Vordergrund. Die Technik- und Naturwissenschaften können auf dem Gebiet große Erfahrungen vorweisen. Nicht jedes Institut hat nun mal alle Geräte zur Verfügung; nicht jede Wissenschaftlerin und nicht jeder Wissenschaftler kann alle Methoden und Techniken beherrschen. Da braucht es Teamwork. Die Geisteswissenschaftler hingegen sind viel weniger auf Zusammenarbeit angewiesen. Sie reisen ja nicht zu dritt in ein Archiv in die Ukraine, um dort nach Unterlagen zur Politik der ehemaligen Sowjetunion zu suchen. Die Geisteswissenschaftler arbeiten eher alleine. Sie diskutieren natürlich, und das gibt ihnen wiederum neue Anregungen, die sie dann aufbereiten. Außerdem braucht sich Freiburg keine Sorgen zu machen, dass die geisteswissenschaftliche Forschung verkümmert: Es gibt hier einen SFB zum Thema Muße und einen zum Thema Helden. Sie sind fast so groß wie Cluster und kosten auch fast genauso viel Geld.
Mangelsdorf: Als Geisteskulturwissenschaftlerin, die 18 Jahre Erfahrung im Wissenschaftsmanagement hat, muss ich sagen, dass sich die Geisteswissenschaftler meistens an die Arbeitsweisen und Strukturen von Natur- und Technikwissenschaften anpassen müssen, die solche Einrichtungen wie Cluster, SFBs oder Graduiertenkollegs dominieren. Es besteht eine Ungleichheit in der Art und Weise, wie unsere Wissenschaften aufgebaut sind. Ich sehe deutlich die Gefahr, dass das nun verstärkt wird.
In Ihrer Stellungnahme fordern Sie, dass die Lehre im Exzellenzwettbewerb nicht zu kurz kommen darf. Ist es denn sinnvoll, einen Forschungswettbewerb mit Lehre zu überlasten?
Osterholt: Wenn in einem Cluster Spitzenforschende zusammenkommen und an einem faszinierenden Projekt arbeiten, das eine gesellschaftliche Relevanz hat, frage ich mich, in welchem Verhältnis diese viel beachtete Gruppe zum Rest der Universität steht. Als Studentin wünsche ich mir schon, dass eine Gruppe, die in meinem Fach oder im Dunstkreis davon gefördert wird, sich auch mir öffnet und dass ich am Erkenntnisgewinn teilhaben kann. Sei es in Form von Workshops, Ringvorlesungen oder unter der Flagge der forschungsorientierten Lehre. Wir haben ja gesehen, dass sich zum Beispiel das Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS) abgeschottet hat und keine Rückbindung mehr an die Universität hatte – davon profitierte also nur eine kleine, ausgewählte Gruppe und nicht die Gesamtheit.

Anna-Lena Osterholt ist internes Mitglied des Universitätsrats und vertritt die Studierenden der Universität Freiburg. Sie studiert Germanistik und Politikwissenschaft auf Lehramt.
Foto: Patrick Seeger
Konze-Thomas: Nun, aber damit war dann ja auch Schluss: Genau diese Abschottung hatten die Gutachterinnen und Gutachter in der zweiten Exzellenzrunde nicht geduldet. Heute hingegen ist das FRIAS eine großartige Einrichtung, die die ganze Universität sowie Bürgerinnen und Bürger aus Freiburg einlädt. Und das ist doch ein positives Zeichen – der Exzellenzwettbewerb legt sehr großen Wert auf Outreach.
Mangelsdorf: Ich erinnere mich gut an die Anfänge des FRIAS, und damals wirkte es ziemlich abschreckend auf mich. So nach dem Motto: Hier sind nur die Besten der Besten, und für alle anderen gibt es keinen Platz. Meine Meinung hat sich aber komplett geändert, seit ich dort an einigen Veranstaltungen teilgenommen habe. Es gibt lebendige Diskussionsrunden, jede und jeder kommt mal zu Wort, und ich finde den Austausch anregend. Seitdem empfehle ich die Veranstaltungen meinen Studierenden, und sie gehen auch hin.
Es ist also eine Frage der Kommunikation?
Mangelsdorf: Ja, absolut. Es kommt darauf an, wie über eine Einrichtung gesprochen wird oder wie sie sich selbst darstellt. Der Exzellenzwettbewerb hat nun mal riesige Auswirkungen, und er wird auch unsere Universität verändern. Ich finde es schade, dass bisher nicht immer klar kommuniziert wurde, wie wir uns einbringen wollen und was unsere Ziele sind. Dabei sehen wir doch, dass genau solche Gespräche wie unsere Diskussion viel ausrichten können. Sie vermitteln Informationen und können Befürchtungen nehmen, die womöglich unberechtigt sind, aber aufgrund von solchen Labels wie „Elite“ oder „Exzellenz“ entstehen.
Stellungnahme zur Exzellenzstrategie von Marion Mangelsdorf und Anna-Lena Osterholt
Exzellenzportal der Universität Freiburg
Universitätsrat der Albert-Ludwigs-Universität